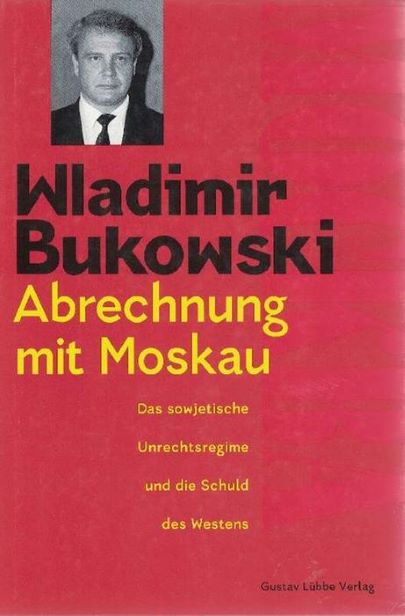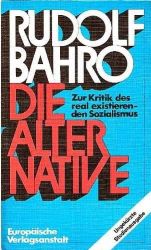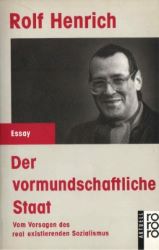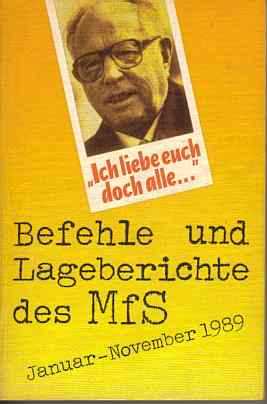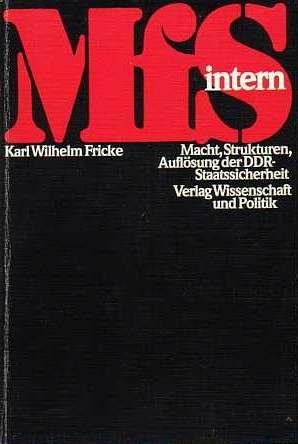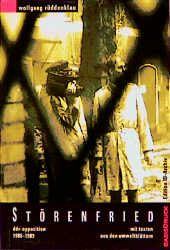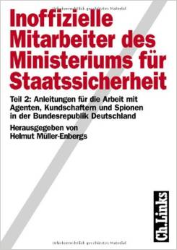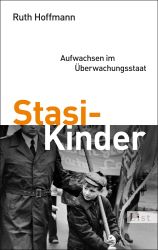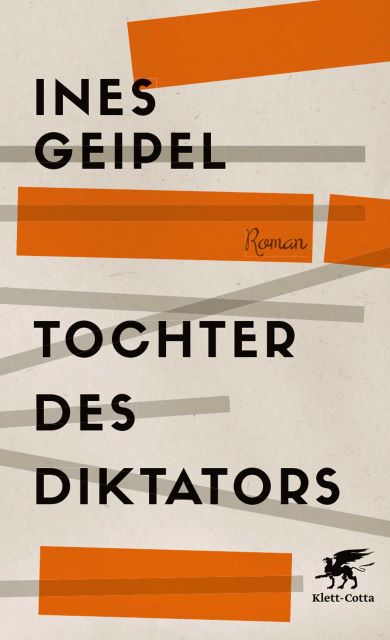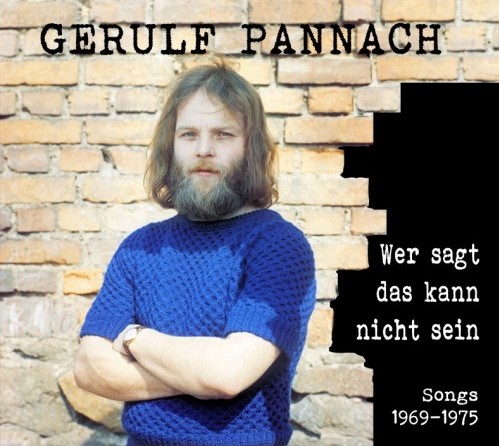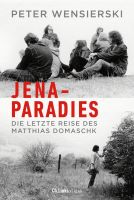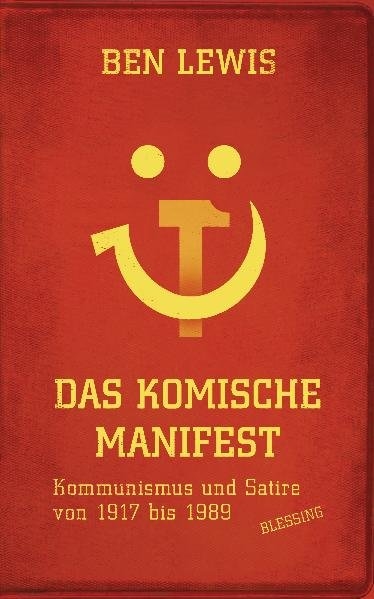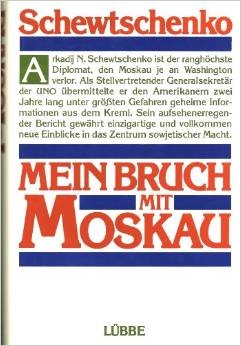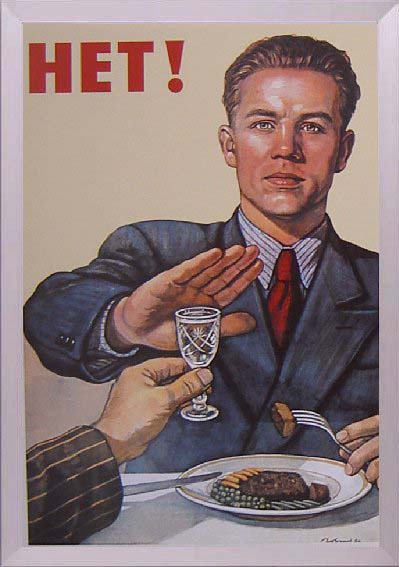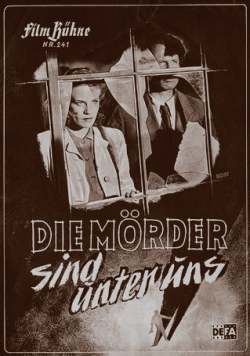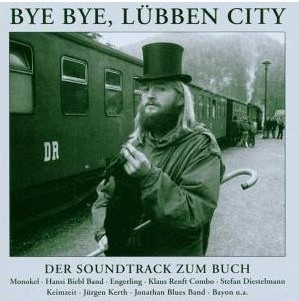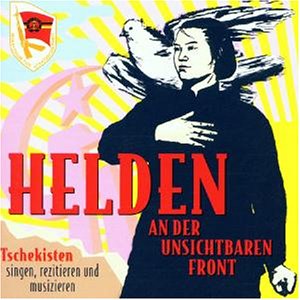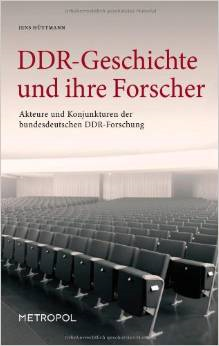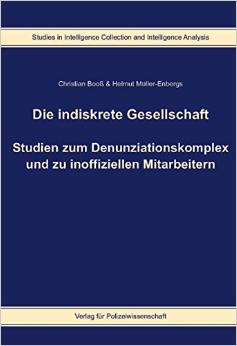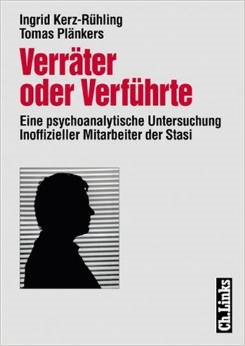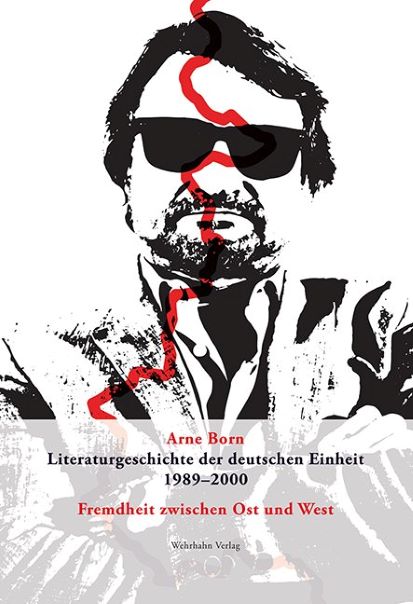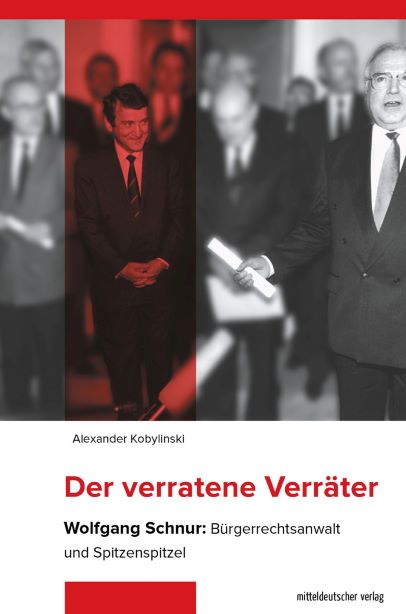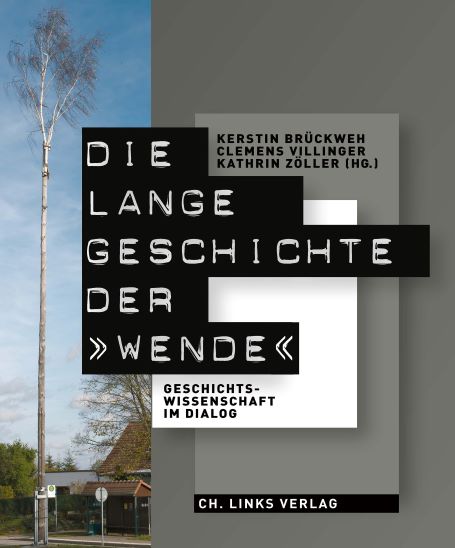|
1958: 10 G E B O T E
für den neuen sozialistischen Menschen
1 DU SOLLST Dich stets für
die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen
sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller
sozialistischen Länder einsetzen.
2 DU SOLLST Dein Vaterland
lieben und stets bereit sein, Deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung
der Arbeiter- und Bauern-Macht einzusetzen.
3 DU SOLLST helfen, die
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen.
4 DU SOLLST
gute Taten für den Sozialismus vollbringen, denn der Sozialismus
führt zu einem besseren Leben für alle Werktätigen.
5 DU SOLLST beim Aufbau des
Sozialismus im Geiste der gegenseitige Hilfe und der kameradschaftlichen
Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und
seine Kritik beherzigen.
6 DU SOLLST das
Volkseigentum schützen und mehren.
7 DU SOLLST stets nach
Verbesserung Deiner Leistungen streben, sparsam sein und die
sozialistische Arbeitsdisziplin festigen.
8 DU SOLLST Deine Kinder im
Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig
gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten Menschen
erziehen.
9 DU SOLLST sauber und
anständig leben und Deine Familie achten.
10 DU SOLLST Solidarität mit
den um ihre nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale
Unabhängigkeit verteidigenden Völkern üben.
WALTER ULBRICHT auf dem V. Parteitag der SED am 10. Juli 1958 in Berlin
2006:
Honeckers Schmuddelkinder - Hippies in der DDR Ein dlf-Feature
von Michael Rauhut
2007:
Wittstock statt
Woodstock - Hippies in der DDR Eine TV-Doku von
Rentner-Sperlich
Bye
bye, Lübben City - Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der
DDR - Buch + Soundtrack-CD von Michael Rauhut und Thomas
Kochan
Die
Hammer-Rehwü 1982
Helden
an der unsichtbaren Front - Tschekisten singen, rezitieren und
musizieren
Das MfS, heute gern salopp "die Stasi" genannt, hat nicht nur
kilometerweise Akten hinterlassen.
Es hat uns auch Musik vererbt, nennen wir es einmal so.
Ein geheimes und bisher unbekanntes Stück deutscher demokratischer
Musikkultur.
Titelliste:
Dynamo-Marsch 1:11 Wir
tragen die roten Spiegel 2:32 Tschekistenlied 2:15 Rückkehr
des Kundschafters -Rezitation- 0:42 Euer Dienst ist die Aufklärung
4:13 Kämpfer an der unsichtbaren Front 3:48 Dank den Genossen
3:35 Wir schützen die Früchte der Revolution 1:48 Signal auf
20! Freie Fahrt! 1:52 Neues Heimatlied 1:58 Einer von uns
-Rezitation- 0:43 Marsch der Kampfgruppen der Arbeiterklasse
2:20 Oktober hat uns geboren 1:34 Jungs aus Moskau
und Berlin 2:10 Zum Parteitag voran 2:20
Arbeitsmänner 2:38 Mein Menschenrecht -Rezitation- 0:47
Dzierzynski-Lied 2:30 An meinem Fenster stehn zwei Blümelein
1:45 Freunde für immer 1:51 Befreiung
-Rezitation- 0:57 Von Regiment zu Regiment 2:16
Soldatenlieder-Folge 3:30 Präsentiermarsch des Wachregiment
Feliks Dzierzynski 2:01 #
Botschaften
aus einem
versunkenen
Reich
Erich
Honecker macht mit Staatsgästen eine "Staatsjagd" auf
Wildschweine.
Aber die Wildschweine haben was gemerkt und verstecken sich im Unterholz.
Drei
Stasi-Leute werden losgeschickt, um sie zu finden und vor die Gewehre zu
treiben.
Nach 5 Stunden sind sie immer noch nicht zurück. Honecker schickt Mielke
los, um sie zu suchen.
Mielke
geht los und sieht auf einer Lichtung seine drei Leute. Die haben einen
Hasen an einen Baum gefesselt
und hauen mit Gummiknüppeln auf ihn ein und schreien ihm ins
Ohr:
"Gib zu, daß du ein Wildschein bist!"
Alles
zum Wohle des Volkes
Arbeite
mit, plane mit, regiere mit
Der
Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist
Die
Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist
Der
Sozialismus ruft uns alle.
(Der
Sozialismus rupft uns alle.)
Der
Sozialismus siegt. (Der Sozialismus
siecht.)
Die
Welt ist erkennbar.
1.
Mai - Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen
Von
der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.
Im
Mittelpunkt steht der Mensch
Jedermann
an jedem Ort - einmal in der Woche Sport!
Mit
jeder Mark, jeder Minute, jedem Gramm Material einen höheren
Nutzeffekt!
( ... koste es, was es wolle!) ( ... bis wir schließlich aus
NICHTS... ALLES produzieren.)
Proletarier
aller Länder - vereinigt Euch!
(Volksmund:
Vegetarier aller Länder - vereinigt Euch!)
Schöner
unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!
Unsere
ganze Schöpferkraft für den Sozialismus
Wir
sind die Sieger der Geschichte.
Wo ein
Genosse ist, da ist die Partei - also die besseren Argumente!
So
wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben
СССР
(kyrillische Schrift,
latinisiert SSSR;
Abkürzung von russisch
Союз
Советских
Социалистических
Республик
Sojus
Sowetskich Sozialistitscheskich Respublik‚
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken‘)
bezeichnet die Sowjet-Union
(UdSSR)
|