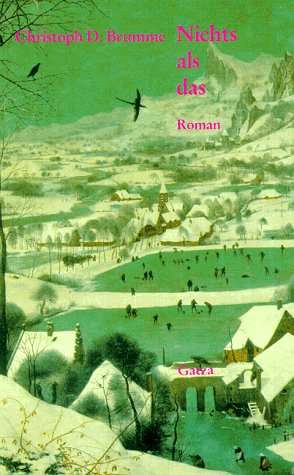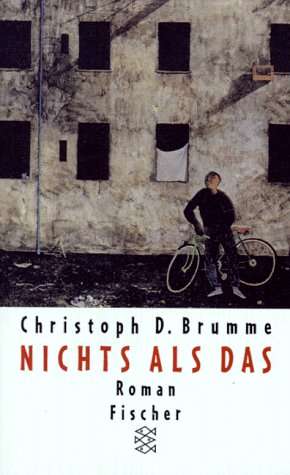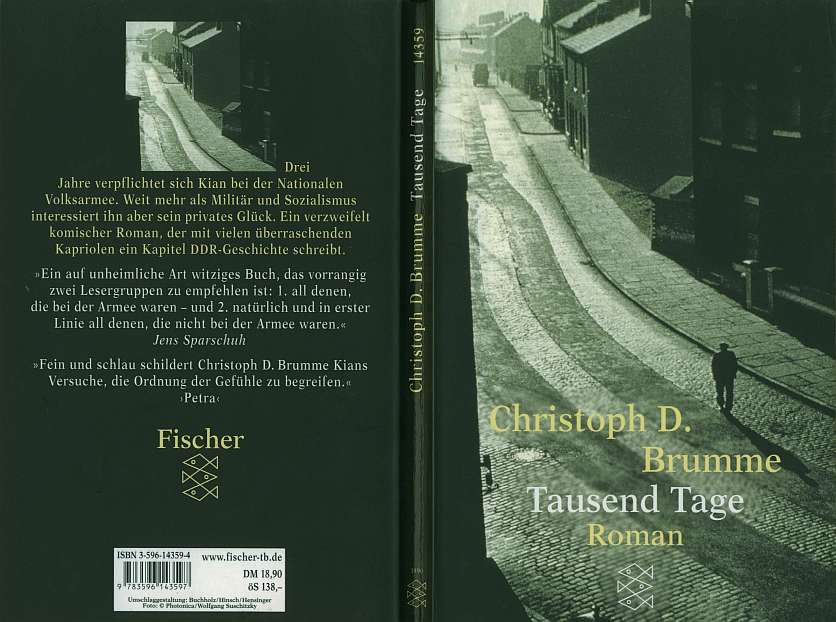DIE
ZEIT 41 / 1997 Von Hajo
Steinert
Das brennende Ei --- "Tausend Tage"
Christoph D. Brumme erzählt vom Alltag in der Nationalen Volksarmee
Tausend
Tage bei der Nationalen Volksarmee - das kann kein Zuckerschlecken sein. Die
Marmelade ist verschimmelt, die Wurst angegammelt, Ratten laufen vor der
Kaserne durch den geharkten Sand. Von morgens bis abends Kniebeugen,
"Rührt euch", "Stillgestanden", Laufschritt,
Sturmgepäck, Stubenkontrolle, Drill und Schikane. Alles ganz gräßlich, aber
ein prima Erzählstoff, im wirklichen wie im literarischen Leben.
"Nehmen
Sie die Hände vom Sack. Wichsen können Sie später!" brüllt der
Leutnant, um des Soldaten Gefühlsregung schon im Keim zu ersticken. Jede
Privatheit wird einem hier ausgetrieben. Und im Politunterricht Parolen über
Parolen, man kann sie sich denken. Da muß einer doch die Krise kriegen.
Kriegt
er nicht. Zumindest nicht der Held dieses Romans. Dem achtzehnjährigen Kian
bietet das Militär einen Ausweg aus der Krise, die einen anderen Namen hat
als NVA: Familie. Endgültig leid war er die gehäkelten Tischdeckchen, Vaters
Pantoffeln im Flur, erst recht dessen Gebrüll. Im Traum hatte er seinem Vater
schon den Kopf abgeschnitten, seiner Mutter die Finger, sich selbst den Penis.
Warum der junge Mann allerdings auch noch von Hitler träumt, bleibt das
psychoanalytische Geheimnis des Autors. Wäre noch Kathrin, die
Miederwarenverkäuferin. Sie backt zwar den besten Kuchen, das erhoffte andere
Leben indes bietet sie dem Helden nicht. Außer Küßchen auf die Wange und
einem läppischen Petting auf dem Wohnzimmersofa ist nichts drin.
"Er
wollte etwas erreichen, was niemand außer ihm erreichen konnte. Er wollte
verblüffen, aber er wußte noch nicht, womit." Freiwillig und für drei
Jahre geht Kian zur Nationalen Volksarmee und macht dort Karriere. Keine
Opfergeschichte also, kein Dokument permanenter Unterdrückung wie Jürgen
Fuchs' autobiographischer Roman aus dem DDR-Soldatenmilieu,
"Fassonschnitt" (1984) Brumme bürstet die Erwartungen des Lesers
gegen den Strich. Kian wird erst Unteroffizier, dann Sekretär, schließlich
bietet ihm - wegen guter Führung - der Geheimdienst einen Job an. Der Pakt
mit dem Teufel wird in letzter Minute eher zufällig vereitelt. Das Happy-End
findet eine andere teuflische Pointe.
Christoph
D. Brummes detailfreudige, sehr atmosphärische, bisweilen etwas
kabarettistische Innenschau einer NVA-Kaserne der achtziger Jahre hätte zu
großen Teilen auch in einer Bundeswehrkaserne entstehen können.
An
Politik ist der Autor genauso wenig interessiert wie seine Hauptfigur. Der
Erzähler erwähnt zwar die Gewerkschaftsstreiks 1980 in Polen, doch für das
Buch spielen die Ereignisse, welche auch die NVA in Alarmbereitschaft
versetzten, keine besondere Rolle. Nach Jens Sparschuh ("Der
Zimmerspringbrunnen") und Thomas Brussig ("Helden wie wir") ist
Christoph D. Brumme (Jahrgang 1962) ein weiterer jener jüngeren Autoren mit
DDR-Biographie, die in ihren Texten zweierlei vermeiden wollen: Bierernst und
Larmoyanz.
Allerdings:
Brummes schnittiger Roman schlägt eine Kapriole nach der anderen von dem
Moment an, da seine Briefgeliebte Kian abblitzen läßt. Sie interpretiert -
tragisch für ihn - mehr in seine Kontakte zum Geheimdienst hinein, als
tatsächlich dahintersteckt. Um den wahren Grund seiner Trauer vor den
Kameraden zu verbergen, versteigt er sich in eine aberwitzige Lüge. Seine
Freundin sei an Krebs erkrankt, deshalb bekomme er keine Liebesbriefe mehr von
ihr. Mit dieser Lüge - auch aus Sicht des Autors eher ein erzählerischer
Noteinfall - setzt sich der Erzähler unter Druck und treibt seine Geschichte
in die Schnurre.
Christoph
D. Brumme ist nicht nur Opfer der Versuchung geworden, vor trostloser Kulisse
eine auf Teufelkommraus abwechslungsreiche Geschichte zu bieten, sondern auch
Opfer seiner Erzählkonstruktion. Einerseits wollte er aus der Perspektive
seines Simplizissimus schreiben, andererseits — der Roman ist nicht in der
Ich-Form gehalten — hat er noch eine Erzählerfigur vorgeschaltet, die die
Irrungen und Wirrungen des Glücksritters unglücklich kommentiert.
Sicher,
der Autor wird für sich das Stilmittel der Ironie reklamieren. Wenn Ironie,
so ist sie in dieser Tragikomödie allerdings von allzu durchsichtiger Art.
Die Unsicherheit des Autors beim Wechsel der Erzählperspektive führt zu
sprachlicher Unentschiedenheit. Mal stößt der Leser auf steifleinene Sätze
("Die Bandbreite der Schikanen, die vor allem Entlassungskandidaten sich
für Soldaten des ersten Diensthalbjahres ausdachten, waren unendlich
weitgefächert"), mal auf schiefen Expressionismus ("Die Sonne hing
als brennendes Ei am Himmel, bereit, herunterzufallen"). Schade,
Christoph D.
Brummes
zweiter Roman konnte nicht halten, was sein Debüt ("Nichts als
das") vor drei Jahren versprach. Sein erzählerisches Talent hat er
dieses Mal an eine krause Geschichte verschwendet — "Er wollte
verblüffen, aber er wußte noch nicht, womit".
Klappentext
3. Roman Süchtig nach Lügen
Zwei
Mittdreißiger im Labyrinth einer leidenschaftlichen Beziehung - eine
mitreißende Geschichte von Liebe, Hass, Unterwerfung und Machtphantasien. Mit
bitterer Komik führt Christoph D. Brumme ein Liebesverhältnis vor, das zum
Verhängnis wird. Bei ihrer ersten Begegnung ist klar, dass etwas noch nie
Dagewesenes beginnt. Hannah zieht ihre Ringe von den Fingern und erzählt zu
jedem eine Geschichte. Alle handeln von Fluchten, und sie ziehen ihr
Gegenüber unwiderstehlich in ihren Bann. Folgerichtig endet der erste Abend
im Bett. Hannah und der namenlose Erzähler werden ein Paar, obwohl sie sich
weigert, ihre Kleider abzulegen. Überhaupt bleibt ihr Verhalten rätselhaft
...
Rezensionen
- Neue Zürcher Zeitung vom 06.03.2003
Um
die Liebe geht es in Christoph Brummes neuem Roman, vielmehr um das Reden
über die Liebe, um hinlänglich bekannte "Wort- und
Scheingefechte", wie Rezensentin Claudia Kramatschek es nennt, Dialoge,
die die Liebe häufig schon verraten, bevor sie richtig beginnt und die nicht
selten, wie auch im vorliegenden Roman, in körperliche Gewalt umschlagen.
Kramatschek findet, dass Brumme die Gestaltung dieses altbekannten Phänomens
wunderbar gelungen sei. Besonders lobt sie seinen schwarzen Humor und den Sinn
für das groteske Detail und bemerkt abschließend, dass Brumme nach seinem
strahlenden Debüt "Nichts als das" von 1994 und dem
darauf folgenden Totalverriss seines 1997 erschienenen zweiten Buches nun
eine "unterhaltsame Rückkehr gelungen" sei.
Rezensionen
- Die Zeit vom 02.10.2002
Der
Titel ist irreführend und verharmlosend, warnt Katharina Döbler, er werde
dem explosiven Inhalt des Romans keineswegs gerecht. Auch die ersten Seiten
des Romans wirkten noch harmlos, wie eine dieser hyperrealistischen
Liebesgeschichten mit viel Sex, die zumindest Döbler nicht mehr aufgetischt
bekommen möchte. Doch schon im vierten Kapitel landet der Leser dort, wo
andere Liebesromane längst zu Ende sind: in der Ehehölle. Szenen einer Ehe,
die Döbler in Kraft und Bösartigkeit ihrer Dialoge teilweise an Edward
Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" erinnern. Überhaupt
findet sie mehr dramatische als epische Elemente in diesem Roman, der ein
ganzes Feuerwerk an Wortgefechten, Beleidigungen, Anschuldigungen abbrennt, um
dann wieder in banalste Alltäglichkeit von schneidender Kälte zu fallen. Es
ist wie beim Fechten, meint Döbler, gewinnen kann keiner, Verletzungen tragen
beide davon. Brummes Blick bleibe mitleidlos. Einziges Manko scheint Döbler,
dass die Rollenverteilung - männlich, weiblich, stark, schwach - ziemlich
lange eindeutig bleibt, doch auch dieses "Gleichgewicht des
Schreckens" komme am Ende ins Wanken. Die Kampfmethoden werden zusehends
unkonventioneller, versichert Döbler.