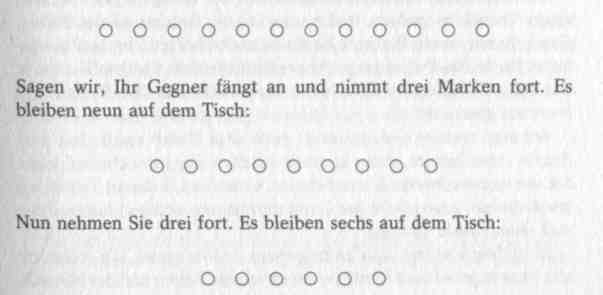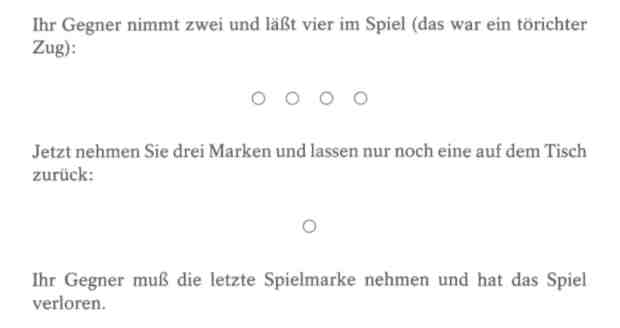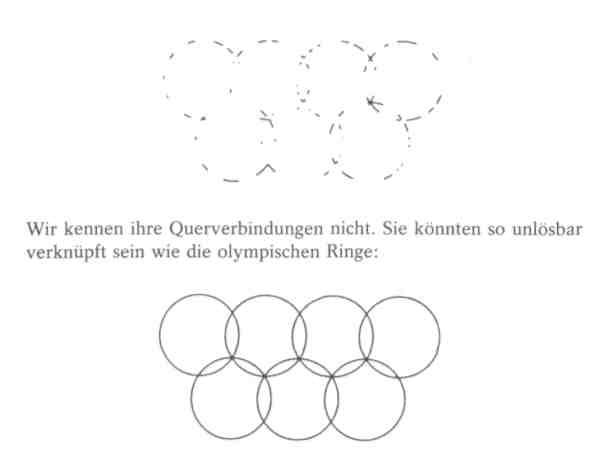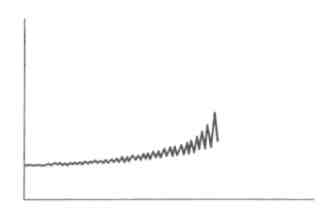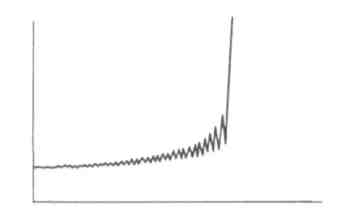Daß
die Erde lebt, ist eine alte Vorstellung. Die meisten Stämme
und Völker teilten sie. Man hat sie ein universales Stadium im primitiven
Denken genannt. Gaia, der Name, mit dem der Wissenschaftler James
Lovelock den lebendigen Planeten bezeichnet, ist der griechische
Name der Mutter Erde. Ihr Name ist auch in dem Wort Geologie
verewigt.
Vielleicht
ist dieses Denken überhaupt nicht primitiv, denn alte und moderne
Denkrichtungen scheinen sich zuweilen einander anzunähern. Oft fällt dieses
Phänomen einem Forscher auf, der sich eingehender mit dem Funktionieren
unseres Planeten befaßt.
Im
17. Jahrhundert kam diese Vorstellung William
Gilbert — einem Physiker am Hofe Elisabeth I. — zu Ohren, dem
ersten Physiker, der erkannte, daß sich die Erde wie ein riesiger Magnet
verhält; und sie kam Johannes Kepler
zu Ohren, der als erster erkannte, daß die Erde und die übrigen Planeten
elliptische Bahnen um die Sonne ziehen.
Im
18. Jahrhundert befaßte sich der Schotte James
Hutton mit dieser Idee. Hutton
studierte in Leyden Physiologie und schrieb seine Doktorarbeit über den
Blutkreislauf. Er praktizierte nie, gelangte aber nach einem lebenslangen
Studium der Geologie dazu, den Planeten so zu sehen, wie William
Harvey den menschlichen Körper sah, als eine wunderschöne Maschine,
lebendig und pulsierend. Er beschrieb die Erde als eine Art Superorganismus,
der angemessen mit einer planetaren Physiologie zu studieren wäre.
Mitte
des 19. Jahrhunderts setzte sich diese Vorstellung im Kopf Matthew
Maurys fest,
seines Zeichens Leutenant bei der Karten- und Instrumentenverwaltung der
amerikanischen Marine. Maury,
ein Pionier in der Erforschung der Meeresströmungen, sah den Planeten als
Lebewesen, dessen Atem der Wind und dessen Blut das Meer ist.
Im
späten 19. Jahrhundert unternahm der russische Universalgelehrte Vladimir
Vernadsky (*1863) in der Ukraine lange Landspaziergänge mit seinem
älteren Cousin Korolenko
(*1853), einem ehemaligen Armeeoffizier, der außerordentlich belesen,
äußerst unabhängig und auf Aphorismen versessen war. Einer der
Lieblingsaphorismen Korolenkos lautete: »Die Welt ist ein lebender
Organismus!«
Diese
Vorstellung prägte Vernadskys Werdegang. Im frühen 20. Jahrhundert widmete
er sich der schwierigen und schönen Wissenschaft, die Hutton
beschrieben hatte, dem Studium des Stoffwechsels und der Physiologie der Erde.
Diese
Männer gehören mit zu den Begründern der modernen Physik, Astronomie,
Geologie, Ozeanographie und Biochemie. Also baut Lovelock
auf einen alten Grund. Er mag recht oder unrecht haben, aber er hat sich nicht
von der traditionellen Geowissenschaft entfernt. In gewisser Hinsicht könnte
man sagen, die Gaia-Theorie entspräche einer orthodoxen Sicht des
Planeten Erde.
Viele
Menschen wenden sich heute mit bestimmten Fragen an Gaia, die frühere
Generationen vielleicht Gott gestellt hätten.
Hutton,
der ganz am Anfang der Industriellen Revolution stand, konnte den ängstlichen
Klang in diesen Fragen nicht voraussehen (obwohl Black,
der Entdecker, und Watt, der
Förderer des Kohlendioxids, zum Freundeskreis Huttons
zählten). Er nahm wahr, daß die Oberfläche des Planeten durch natürliche
Ursachen ständig abgetragen wird, daß seine Ufer weggeschwemmt, seine Berge
ins Meer gespült werden.
Er
wunderte sich über dieses langsame und unaufhaltsame Vergehen des Planeten.
Als ehemaliger Mediziner fühlte er sich zu folgenden Fragen veranlaßt: Aber
soll man deshalb die Welt nur als eine Maschine betrachten, die nicht
länger bestehen wird, als ihre Teile ihre gegenwärtige Anordnung,
funktionsfähigen Formen und Eigenschaften beibehalten? Oder könnte man sie
vielleicht als einen belebten Körper sehen, der so beschaffen ist,
daß die unumgängliche Abnutzung der Maschine auf natürliche Weise behoben
wird?