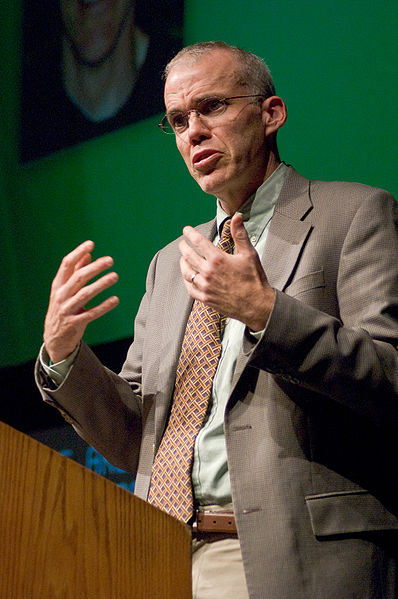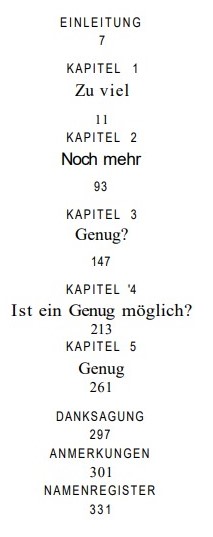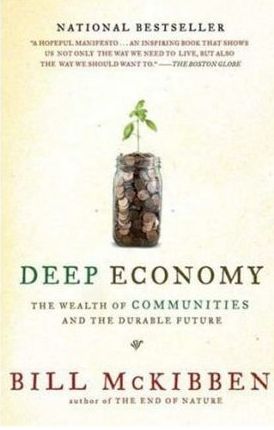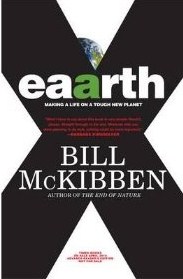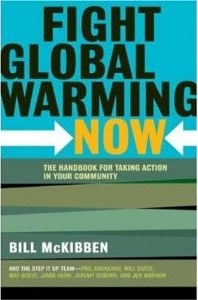|
2004 Genug!
Der Mensch im Zeitalter seiner
gentechnischen Reproduzierbarkeit / Bill McKibben / 333 Seiten
Klappentext
In
seinem früheren Bestseller <Das Ende der Natur> legte McKibben dar, dass
die Menschheit unwiderruflich damit begonnen habe, ihre Umwelt global zu
verändern - und zu gefährden.
Nun
richtet er sein Augenmerk auf eine Reihe von Technologien, die womöglich
unser Verhältnis nicht zur übrigen Natur, sondern zu uns selbst
verändern werden.
Er
lotet kritisch die Grenzen von Gen- und Nanotechnologie sowie der
Entwicklung von Robotern aus, Grenzen, denen wir uns mit erstaunlicher
Geschwindigkeit nähern.
dnb Buch
aus
perlentaucher
Genug
zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.06.2004
Bill
McKibben glaubt den Genetikern nicht, wenn sie beteuern, den Menschen gar
nicht optimieren zu wollen und warnt mit allem, was die populistische
Rhetorik zu bieten hat, vor Gentechnik, Nanotechnik und Robotik. Diese
Technologien, so seine dringliche Botschaft, werden in "einen
düsteren Zusammenfluss" münden.
Und
tatsächlich: Manuela Lenzen ist aufgerüttelt worden, aber anders, als
der Autor es im Sinn hatte. Diese ganzen apokalyptischen Visionen hat sie
nämlich schon so oft gehört, dass sie beim Lesen
merkte, wie abgestumpft sie schon war. Das "Alarmpotential des
Themas", es ist verbraucht.
Das
aber hat die Rezensentin viel mehr erschreckt als die Schwarzmalerei
McKibbens: "Wo ein Risikokomplex wie GNR nur lange und laut genug
beredet wird", so ihr Gedanke, "da scheinen sich alle Bedenken
wie von selbst in den Wind zu schlagen".
Keiner
hört mehr zu, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ihr Dank gilt also nicht
dem Aufklärer, sondern dem "Spätzünder" McKibben. Was
allerdings nicht unbedingt eine Lektüreempfehlung ist.
zu
Süddeutsche Zeitung, 14.11.2003
Der
homo sapiens als auslaufender "Untermensch", Maschinen, die nach
Belieben Atome und damit chemische Verbindungen zusammensetzen können,
und nie wieder duschen - Willy Hochkeppel hat sich einigermaßen gegruselt
in Bill McKibbens posthumanistischen "Schreckenskabinett", was
aber nur zum Teil an dem liege, was eine entfesselte Genetik,
Nanotechnologie und Robotik so hervorbringen könnte.
Ursache
seiner Beklemmung war vor allem der Autor, der diese Horrorszenarien
zunächst reißerisch-raunend vorführe, um sich dann als "Rufer in
der Wüste" und Anwalt der menschlichen Natur zu gebärden - wie es
eben Usus sei, wenn man sich auf das Geschäft der bestens verkäuflichen
populärwissenschaftlichen Dutzendware verlegt hat.
Mit
lockerer Reporterschreibe, so Hochkeppel, werden in diesem Buch
Sensationen präsentiert und Ängste geschürt.
Was
aber gegen die blinde Zukunftsgläubigkeit getan werden könne, dazu habe
McKibben nichts beizusteuern.
Das Fazit: "unverdaulich". |