#
https://gsp-ev.de/nachruf-prof-dr-theol-dr-phil-siegfried-keil/ 2018
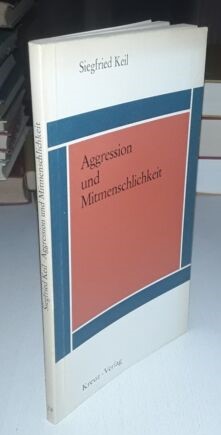
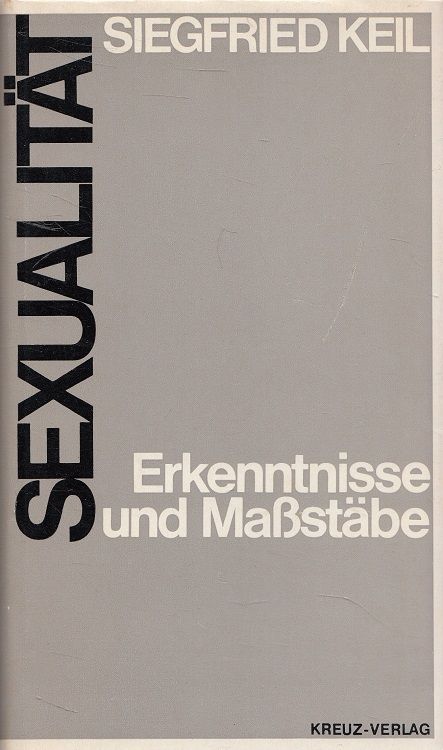
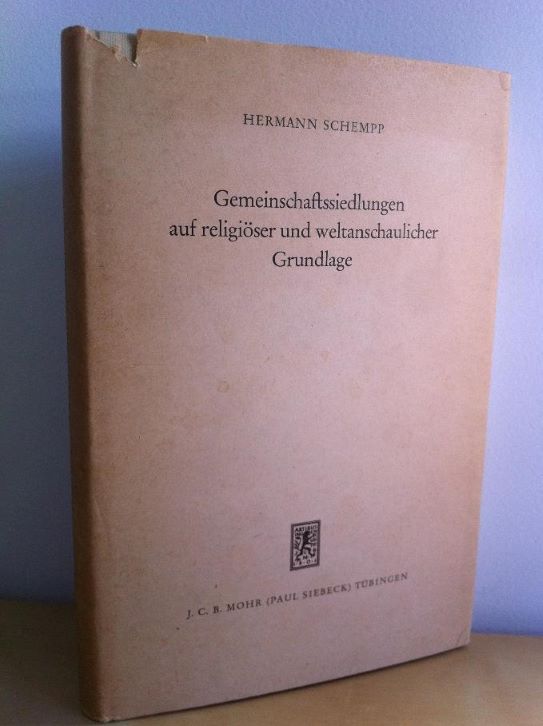
(8) Start
Hoffnung auf einen neuen Menschen?
Siegfried Keil 1971 - evangelischer Theologe und Sozialethiker - wikipedia Siegfried_Keil *1934 in Kiel bis 2018 dnb.Person dnb.Nummer (28)
Die große Hoffnung steht am Anfang
190-219
Wo immer Neues beginnt, ist es in der Regel mit Hoffnung verbunden. Hoffnung hat uns begleitet, schon ehe wir geboren wurden. Voller Hoffnung haben unsere Eltern unsere ersten Schritte ins Leben verfolgt. Unsere eigene Hoffnung steht am Anfang wichtiger Einschnitte unseres persönlichen Werdeganges, wie Schulbeginn und -abschluß, Gesellenprüfung und Examen, Eheschließung und Geburt unseres ersten Kindes.
Je nach den Lebensumständen und persönlichen Voraussetzungen mag die Hoffnung bei den einzelnen Menschen verschieden groß sein, aber fehlen darf sie nirgends, wenn Leben möglich bleiben soll. Hoffnung ist lebensnotwendig. Hoffnungslosigkeit führt zum Tode. Wer einmal einen hoffnungslosen Menschen, ein Kind oder einen Erwachsenen, gesehen hat, wird das empfunden haben. Der Psychoanalytiker Erik Erikson nennt darum die Hoffnung „Die früheste wie die unentbehrlichste Tugend" (Einsicht 104), die zum Lebendigsein des Menschen dazugehört.
Diese Tugend ist nicht einfach angeboren, ist kein biologisch gesicherter Tatbestand, nicht triebhaft oder instinktiv im Menschen festgelegt, sondern muß in den sozialen Beziehungen der Menschen entwickelt, geschützt, bewahrt und gestärkt werden. Die ersten Regungen des Säuglings, sein hoffnungsvoll suchendes Riechen, Schmecken und Tasten, sein Schreien und sein Lächeln erwecken und stärken die Hoffnung seiner Eltern, daß hier ein lebensfähiger Mensch heranwächst, der sie braucht und auf sie angewiesen ist. Ihre Antwort und Zuwendung, ihr Reinigen und Nähren, ihre Stimme und ihre lächelnde Erwiderung vergrößern die Hoffnung, das Vertrauen und die Zuversicht des Neugeborenen. Diesen „sozialen Optimismus" (Familie 82), von dem der Soziologe Dieter Claessens spricht, braucht der Mensch, um am Leben zu bleiben. Das gilt für den einzelnen und die Gesellschaft wie für die Menschheit als ganze.
Darin mag die tiefere Ursache dafür liegen, daß wir oft gerade nach herben Enttäuschungen und Katastrophen um so größere Hoffnungen in den neuen Anfang setzen. So folgt auf eine enttäuschende Schulzeit nicht selten ein um so hoffnungsvollerer Start in das Berufsleben. So reagiert manch junger Mensch auf die Enttäuschungen in seinem Elternhaus, indem er voller Hoffnung, in der Regel viel früher als seine Eltern und Großeltern, eine feste Bindung mit einem gegengeschlechtlichen Partner eingeht. Nicht wenige der viel zitierten Frühehen mögen hier ihren Ursprung haben. Und wie viele junge Eltern erwarten voller Hoffnung ihr erstes Kind, um ihm die Enttäuschungen, die ihnen selbst durch das Leben widerfahren sind, zu ersparen, um die Erziehungsfehler zu vermeiden, die an ihnen verübt worden sind, um es die Ziele erreichen zu lassen, vor denen sie selber gescheitert sind.
Hoffnung gehört dazu, wenn das Leben weitergehen soll. Und je deutlicher sich in unserem Leben Einschnitte abzeichnen, in denen etwas Neues beginnt, desto leichter scheint es zu sein, von neuem Hoffnung zu schöpfen. Am Anfang von etwas Neuem Hoffnung zu haben, ist offensichtlich leichter als Hoffnung durchzuhalten im tristen und konturlosen Einerlei der Jahre.
Vielleicht wirken manche, gerade auch junge Menschen so hoffnungslos, weil in ihrem Leben so wenig Konturen erkennbar sind, weil die Zeit des Lernens vom Schuleintritt bis zum Ende der Berufsausbildung immer länger wird und die einzelnen Abschnitte immer weniger deutlich unterschieden ineinander übergehen. Sicher gilt aber auch für diese Lebensphase, was über die Hoffnung des Säuglings gesagt wurde: daß sie aus der Hoffnung derer lebt, die ihnen begegnen. So spiegelt das von wenig Hoffnung zeugende Erscheinungsbild vieler junger Menschen die Haltung ihrer Eltern, Erzieher und Vorgesetzten.
Dabei war der Lebensweg dieser Generation, der heute Erwachsenen, ebenfalls von hoffnungsvollen Erwartungen begleitet, die in tiefsten Katastrophen, wie der von 1945, den Neuanfang ermöglicht haben. Ist es die Enttäuschung der sechziger Jahre, die hier spürbar wird, daß doch alles oder wenigstens vieles beim alten geblieben ist, weil die Menschen die gleichen bleiben, die keinen Neuanfang wirklich nutzen können, weil sie "keine Experimente" wollen, sondern Sicherheit?
Diese Parole hat die politische Bühne in Westdeutschland immerhin über zwanzig Jahre lang stabilisieren geholfen und einen Wechsel in der Regierungsverantwortung verhindert. Die Menschen bleiben die gleichen trotz vieler Neuanfänge in ihrem persönlichen Leben und trotz mancher Umbrüche in Kirche, Staat und Gesellschaft.
191
Diese Erfahrung hat nicht verhindern können, daß Reformation, Französische Revolution und Ende des NS-Terrors mit großen Erwartungen verbunden waren. Ja, diese Hoffnung hat die Entwicklung der Völker vorangetrieben, so daß wir mit manchen Einschränkungen dennoch von einem Fortschritt der menschlichen Entwicklung sprechen können. Aber auch die tiefsten Einschnitte und Erneuerungen im sozialen Gefüge menschlichen Zusammenlebens haben den Menschen selbst nicht so entscheidend geändert, daß er sich und anderen nicht immer wieder schwere Enttäuschungen zufügen konnte.
Darum regt sich gerade in unseren Tagen, in denen die menschlichen Möglichkeiten ins Unermeßliche gesteigert wurden, immer drängender die Frage: gibt es eine Hoffnung über alle bisherigen Hoffnungen hinaus, die Hoffnung auf einen neuen Menschen, der den gesteigerten Möglichkeiten gewachsen ist und nicht in grenzenloser Enttäuschung bis hin zur totalen Selbstvernichtung endet?
Mit dieser Frage nach dem neuen Menschen wird ein Gedanke aufgegriffen, der schon einmal eine Zeitenwende eingeleitet hat, den Beginn des christlichen Abendlandes. Im Neuen Testament steht der Satz: „Das Alte ist vergangen, siehe es ist neu geworden" (2. Kor. 5,17). Und diese Aussage meint nicht die äußeren Umstände und Lebensverhältnisse, nicht den Abschluß einer erfolgreichen Revolution, nicht das Ende einer Verfassungs- oder Kirchenreform, nicht die Neugründung eines von fremdem Joch befreiten Staates, sondern den Menschen selbst.
Jesus und die Apostel verkünden ihrer Umwelt den neuen Menschen. Jesus sagt im Gespräch mit Nikodemus: „Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen" (Joh. 3,3). Und Paulus spricht davon, daß der alte Mensch in der Taufe stirbt, damit „wir in einem neuen Leben wandeln" (Rö. 6,4). An anderer Stelle ist auch davon die Rede, daß der alte Mensch ausgezogen wird, um den neuen Menschen anzuziehen (Kol. 3,9 und 10).
Uns mögen diese Sätze heute abgedroschen und phrasenhaft klingen, weil wir sie zu oft gehört haben, ohne eine Wirkung zu sehen. Vielleicht erinnern sie den einen oder anderen auch an unangenehm frömmelndes Drängen auf die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Zu ihrer Zeit stellten sie aber eine ungeheure Zumutung dar, die in der Gegenfrage des Nikodemus zum Ausdruck kommt: „Wie kann der Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden?" (Joh. 3,4). Darin steckt nicht nur der Protest gegen die biologische Unmöglichkeit, sondern auch der Widerstand gegen die Abwertung des Alten, die die Verkündigung Jesu und der Apostel durchzieht.
192
„Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: „Ich aber sage euch ..." (Matth. 5,21 und ö.), diese Formulierung Jesu war für die Ohren der gesetzestreuen, dem Alten verpflichteten Juden ein Greuel.
Nicht anders haben die Griechen und Römer empfunden, als das Christentum zu ihnen vordrang. Für sie hatte das Alte seinen besonderen Wert, und die Alten besaßen herausgehobene Autorität, weil das Alter näher an den Ursprüngen war. Das goldene Zeitalter lag in der Vergangenheit und die Gegenwart entfernte sich immer mehr von dem überlieferten Guten, von den Sitten und Gebräuchen der Vorväter. Da galt es, wenigstens die Reste des Alten zu bewahren und die alten Menschen als die Bewahrer der Tradition zu ehren. Durch die neutestamentliche Botschaft wurden diese Vorstellungen auf den Kopf gestellt. Das Alte und die Vergangenheit verloren ihren Wert zugunsten der Gegenwart und der Zukunft. Die Lebensalter wurden unbedeutend unter der Ansage des neuen Menschen, die alten und jungen Menschen in gleicher Weise galt und für beide einen radikalen Neuanfang bedeutete.
Vielleicht wäre das Ärgernis bei Juden und Heiden nicht so groß gewesen und hätte nicht zum Kreuzestod Jesu und zum Märtyrertod vieler seiner Anhänger geführt, wenn es beim Reden vom neuen Menschen geblieben wäre. Aber der neue Mensch wurde nicht nur als Inhalt einer Hoffnung für die ferne Zukunft verheißen, sondern in der Gegenwart gelebt. Sichtbar wurde dieser Sachverhalt in der neuen Moral und dem völlig anderen sozialen Verhalten der Christen. Der freie Umgang mit den Verhaltensregulierungen, die in ihrer Umwelt galten, und die unbefangene Zuwendung zur Realität, die nicht an Standes- oder Volksgrenzen halt machte, mußte denen auffallen und anstößig erscheinen, die in der Beachtung religiöser und weltlicher Vorschriften, Gebote und Satzungen ihr Heil suchten und die sich von allen fernhielten, die anders waren und die geltenden Regeln nicht einhalten wollten oder konnten.
Was Jesus praktiziert hat im Umgang mit Zöllnern und Dirnen oder in der Übertretung der Sabbatruhe, wenn es galt Menschen zu helfen, hat Paulus als Theologe formuliert: „Alles ist mir erlaubt; aber nicht alles ist heilsam. Alles ist mir erlaubt; aber ich darf mich durch nichts beherrschen lassen" (l.Kor. 6,12). Diese Freiheit und Unbefangenheit macht den neuen Menschen aus, der in der Gestaltung seines Lebens und Zusammenlebens nicht darauf angewiesen ist, nach bestimmten Vorschriften zu handeln und vorhandenen Institutionen Dauer zu verleihen. Die Blutsbande der Verwandtschaft traten zurück zugunsten der Bruderschaft der Gleichgesinnten. Die Bindung an Eigentum und Besitz wurde aufgehoben in der Lebens- und Gütergemeinschaft der Urgemeinde in Jerusalem. Ledigsein und Kinderlosigkeit erhielten einen neuen Wert neben Ehe und Elternschaft.
193
Maßstab für das Verhalten waren nicht mehr feststehende Regeln, die im einzelnen vorschrieben, was einer zu tun und zu lassen hatte, sondern Gesichtspunkte der Lebensförderlichkeit, des Nutzens für das Leben und Zusammenleben der Menschen. Unter dieser Maxime galt es, alles zu prüfen und nur das Beste zu bewahren.
Die Haltung des neuen Menschen, wie sie unter den ersten Christen verkündigt und realisiert worden ist, lebte aus der Hoffnung auf den baldigen Anbruch der Gottesherrschaft. Diese Hoffnung richtete sich nicht auf ein fernes, unerreichbares Jenseits, sondern auf die Verwirklichung der Gottesherrschaft auf einer neuen Erde, auf der „kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen" (Offb. 21,4). So sehr die Christen darauf vertrauten, daß dies in naher Zukunft deutlich und für alle sichtbar in Erscheinung treten würde, glaubten sie doch, daß der Anfang in dem Leben Jesu Christi schon geschehen war und lebten danach. Sie lebten in der erfüllten Zeit. Das Alte war schon vergangen, und die neuen Lebensmöglichkeiten waren offenbar geworden. Für den, der diese neuen Möglichkeiten im Glauben ergriff, konnte die Zukunft Gegenwart werden, nicht nur in der Gefühls- und Gedankenwelt der Menschen, sondern in der Art und Weise, wie sie miteinander lebten und umgingen. Aus dieser Erneuerung des Menschen und der Erweiterung seiner Möglichkeiten konnten sich dann auch, sozusagen von innen heraus, die Verhältnisse ändern. Die Hoffnung auf den neuen Menschen stand am Anfang. Wo und insoweit diese Hoffnung ergriffen wurde, kam es zu neuen sozialen Formen. Sie waren nicht das eigentliche Ziel der neutestamentlichen Verkündigung. Man muß deshalb tiefer blicken, wenn man entdecken will, welche Anstöße für die Entwicklung unserer westlich-abendländischen Kultur und Zivilisation dem neuen Menschen, seiner Unbefangenheit und Freiheit, seinen neuentdeckten Möglichkeiten des realistischen Umgangs mit der Welt zu verdanken sind.
Der Marburger Sozialethiker Dietrich von Oppen nennt den neuen Menschen den sachlichen Menschen und meint damit im besonderen die durch Jesus Christus ermöglichte „freie Sachlichkeit, die sich von ideologischen und anderen Einseitigkeiten und Voreingenommenheiten frei zu halten sucht" (Mensch 196). Wissenschaft und Technik, Demokratie und Sozialismus, die Verkündigung und zunehmende Realisierung der Menschenrechte wären ohne den neuen, ohne den sachlichen Menschen nicht denkbar gewesen. Die aktive Hoffnung auf eine neue Welt, die den Einsatz für ihre Realisierung einschließt, hat immer wieder Menschen befähigt, die menschliche Entwicklung gegen den Widerstand der Hoffnungslosigkeit und der Angst voranzutreiben.
194
Die Angst ist größer
Die große Hoffnung, die am Anfang des Christentums stand, konnte immer weniger durchgehalten und bewahrt werden. Der glaubende Christ kann zwar darauf hinweisen, daß die christliche Hoffnung sich von allen anderen menschlichen Hoffnungen unterscheidet, weil der neue Mensch als von Gott ermöglichtes Sein in Jesus von Nazareth Gestalt angenommen hat. Der neue Mensch ist daher nicht Programm oder Forderung, sondern eröffnete Möglichkeit. Für den, der sich auf das Risiko des Glaubens einläßt, gewinnt das neue Sein Realität. Dieses Risiko erscheint aber vielen als zu groß. Die Angst vor der Unsicherheit, in die man geworfen wird, wenn man alle Sicherungen des alten Menschen durch Sitte und Tradition, durch Gesetz und Institution aufgibt, war zu mächtig, als daß die christliche Botschaft sie bei ihrer schnellen Verbreitung um das Mittelmeer und in Europa im ersten Anlauf hätte überwinden können.
In dieser Phase der Entwicklung wurde das Christentum zum Programm, wurde aus dem Angebot des neuen Seins die Forderung, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Und damit waren die Voraussetzungen gegeben, daß auch die christliche Hoffnung auf den neuen Menschen ein ähnliches Schicksal erlitt wie viele Anfangshoffnungen vorher und nachher. Sie verkümmerte und konnte nur gegen den äußerlich sichtbaren Augenschein als eine unterschwellig wirksame Kraft erfahren werden. Der alte Mensch braucht Garantien dafür, daß er sich richtig verhält. Er braucht unverbrüchliche Ordnungen, in denen er mit anderen zusammen leben kann. Er muß Freund und Feind unterscheiden können. Er muß wissen, wer über ihm steht und wen er unter sich hat. Er meint, seines Lebens mächtig bleiben zu müssen und nimmt in Kauf, daß andere über ihn Macht gewinnen. So gebar die Angst vor der Unsicherheit den Kampf um die Macht, wie er im Mittelalter in den Kämpfen zwischen Kaiser und Papst historisch seinen ersten weithin sichtbaren Ausdruck fand. Von daher wird es verständlich, daß andere die Geschichte der verborgenen Hoffnungen, von der oben die Rede war, als eine Geschichte des Kampfes um die Macht beschreiben können.
Im Verlaufe dieses Kampfes entstand unter christlichem Vorzeichen ein neuer Kosmos der Zuständigkeiten und Regelungen des Daseins, das Corpus Christianum. In ihm hatte jeder seinen ihm von Gott zugewiesenen Ort, war das Leben und Zusammenleben sakral überhöht und sicherte dem einzelnen seinen Platz in dieser und in jener Welt. Das Individuum war in def Regel fest in die Familie eingegliedert, die in Gestalt der Großfamilie und des Familienbetriebes Lebens- und Arbeitswelt in einem war.
195
Die Familie wiederum war ein fester Bestandteil der Nachbarschaft und des Dorfes. Und die Kirchengemeinde umschloß sie alle: Eine abgeschlossene Welt im kleinen, in der das Leben, von Sitte und Tradition geprägt, den Menschen kaum zu eigenen Entscheidungen herausforderte. Arbeit und Freizeit, Alltag und Sonntag, Sommer und Winter, Jugend und Alter bestimmten den Rhythmus des Lebens. Jedes hatte seinen Platz und seine Ordnung. Die Kirche stand nicht nur äußerlich in der Mitte dieser kleinen Welt, sondern auch innerlich. Ihre Werte wurden von den anerkannten Persönlichkeiten verbindlich vorgelebt und tradiert. Gerhard Wurzbacher sagt in einer Beschreibung der vorindustriellen Verhältnisse: Auf Grund der angeführten Tatbestände besaß man eine „große Verhaltenssicherheit bei relativ abgeschlossener Daseinsweise." Sobald diese Abgeschlossenheit jedoch gestört wurde, entstand eine „große Unsicherheit bei Begegnung mit fremden Lebensformen" (Arbeiterin 19).
Solche Begegnungen mit fremden Lebensformen waren allerdings in jener Zeit äußerst selten, weil auch die Welt außerhalb der Familie und des Dorfes im Grunde nach den gleichen Prinzipien aufgebaut war. Das Land mit seinem Landesvater und seiner Landesmutter an der Spitze legte sich gewissermaßen nur wie ein weiterer Ring um Familie, Nachbarschaft, Dorf und Kirchspiel herum. Die Landeskinder hatten auch hier den gleichen Gesetzen zu folgen. Entsprechendes galt für die Angehörigen der geistlichen Orden oder etwa auch für die Soldaten, die außerhalb ihres blutsmäßigen Familienverbandes lebten. Man hat darum auch von einem System konzentrischer Kreise gesprochen, in dem die einander umgreifenden immer größeren Lebensbereiche nach der gleichen inneren Struktur aufgebaut waren. Besonders deutlich tritt dieser Sachverhalt in der Struktur der Autorität in der vorindustriellen Zeit hervor.
Das vorherrschende Leitbild war die väterliche Autorität. Jede Vorgesetztenposition wurde an diesem Leitbild gemessen und mit der Vaterrolle identifiziert. Die berufliche, kirchliche und staatliche Hierarchie war eine Hierarchie der Väter. Vom Familienvater über den Landesvater und den Heiligen Vater bis hin zum Himmlischen Vater war die Autorität einheitlich begründet und von der Autorität Gott Vaters abgeleitet. Jeder Protest an irgendeiner Stelle wurde als Protest gegen die gesamte Autoritätspyramide empfunden und als solcher geahndet. Jeder Zuwachs an Autorität in irgendeinem Amte erweiterte auch die Autorität in allen anderen Ämtern. Vereinigte gar ein Vater mehrere Vaterrollen als Familienvater, Handwerksmeister oder Kaufherr, Bürgermeister oder Senator in seiner Person, trugen alle diese verschiedenen Rollen zu seiner Gesamtautorität bei. Sie wurde nicht von Fall zu Fall unterschieden, sondern als Einheit gesehen.
196
Ein solcher „vielfacher" Vater konnte seine vermehrte Autorität auch gegenüber seinen Kindern noch ganz anders einsetzen als ein „einfacher" Vater, der eben nur Familienvater war. Hinter dieser äußerlichen Harmonie und Einheitlichkeit stand ein hoch-differenziertes Normengefüge unterschiedlicher Rechte und Pflichten für die einzelnen Stände und Personenkreise. Diese Vorschriften reichten in alle Bereiche des Lebens hinein und erstreckten sich auf Kleiderordnungen, Hochzeitsordnungen, Zunft- und Genossenschaftwesen, kirchliche und militärische Verpflichtungen und vieles andere mehr. In keinem Sektor des öffentlichen und privaten Lebens galten zu jeder Zeit und für jedermann die gleichen Normen. Der einzelne war vielmehr eingebettet in eine groß angelegte, institutionalisierte, ständische Gesellschaftsordnung und hatte die Normen zu befolgen, die für seinen Stand und seine Position zutrafen. Individuelle und persönliche Freiheit, gleiches Recht für alle und andere uns selbstverständliche Voraussetzungen einer menschenwürdigen Existenz waren in dieser Zeit, trotz mancher fruchtbaren Ansätze in Renaissance, Reformation und Aufklärung, noch nicht verwirklicht.
Die Hoffnung der Menschen in diesen Jahrhunderten richtete sich, wenn sie die Ungerechtigkeit ihres Lebens empfanden, auf einen Ausgleich im Jenseits. Es gab Perioden, in denen die Herrschenden daraus noch ein Geschäft zu machen verstanden und die Bedrohung dieser Jenseitshoffnung als zusätzliches Mittel der Unterdrückung einsetzten. Bis zu den Revolutionen in Amerika und Frankreich versuchten nur einzelne religiöse Minderheiten, ihre Hoffnung direkt in soziale Aktivität umzusetzen. Die Mehrzahl der Menschen konnte das System als sinnvolle Ordnung des öffentlichen und privaten Bereiches erleben, die die optimale Sicherheit des Daseins garantierte und die Angst vor den dunklen Mächten in einem selbst und vor den Gefahren um einen herum zudeckte. Die Verfolgung der Außenseiter der Gesellschaft, wie Ketzer, Hexen oder Juden, als den Symbolfiguren für das Böse, ermöglichte es auch noch der untersten Schicht, sich mit der Ordnung im ganzen zu identifizieren.
Inzwischen ist die Decke zu kurz geworden, um die Angst zuzudecken. Alte Formen und Ordnungen sind zerbrochen. Sie haben sich gegenüber einer in zunehmend schnellerem sozialem Wandel befindlichen Wirklichkeit nicht behaupten können. Darüber sind viele Menschen beunruhigt. Diese Beunruhigung ist verständlich, weil die überlieferten Vorstellungen von Gut und Böse, von Recht und Unrecht, die den Menschen bisher Verhaltenssicherheit vermittelt haben, im Schwinden sind, ohne daß schon jetzt neue ebenso klare wie allseitig anerkannte Maßstäbe an deren Stelle getreten wären.
Die hier angedeutete, aus der Unsicherheit gegenüber dem Neuen geborene Angst
197
wird nicht geringer, wenn man mit Recht darauf hinweist, daß es für viele Bereiche des Lebens nicht nur in der augenblicklichen Übergangszeit, sondern auf Dauer keine eindeutigen Verhaltensregeln mehr geben wird. Besonders in dem Erlebnisbereich von Sexualität, Ehe und Familie verdichtet sich diese Problematik mannigfaltig, denn diesem Bereich kann sich niemand entziehen.
Der Mensch ist nur Mensch, sofern er Mann oder Frau ist. Darum betreffen alle Wandlungen in den Vorstellungen von dem, was als männlich oder weiblich gilt, und alle Veränderungen in der Art und Weise, wie Männer und Frauen zusammenleben, den einzelnen unmittelbar. Die Politik mag ihm gleichgültig sein. Auch gegenüber den Fragen der Wirt-schafts- und Arbeits weit kann er sich taub stellen. Hier wie dort mögen „die da oben" die Weichen stellen und die Entscheidungen fällen, die der gesellschaftliche Wandel notwendig macht. Man selbst bleibt lieber Zuschauex oder Mitläufer. Auch wenn man die Folgen einer falschen Politik, einer Mißwirtschaft und einer mangelnden Berufsplanung am eigenen Leibe zu spüren bekommt, wird der Schritt zur eigenen Aktivität und zum gesellschaftlichen Engagement in der Regel nur von einer Minderheit vollzogen. Das bedeutet, daß in unserem Staat zwar demokratische Formen entwickelt wurden, daß diese aber bisher kaum im Denken, Fühlen und Handeln des einzelnen verankert sind.
Die demokratische Grundeinstellung der Staatsbürger und ihre eigene Beteiligung am öffentlichen Leben müssen daher in unserer Gesellschaft erst noch eingeübt werden. Im Umkreis der Sexualität ist diese distanzierte Zuschauer- oder Mitläuferhaltung nicht so ohne weiteres möglich. Selbst wenn man sich weitgehend der Umwelt anpaßt und bemüht ist, den Modellen und Klischees der kommerziellen und ideologischen Meinungsbildner zu entsprechen, bleibt die Sexualität, wie der amerikanische Soziologe David Riesmann gesagt hat, „das letzte Abenteuer". Welche Erfüllung der einzelne in seiner Existenz als Mann oder Frau findet, und wieviel Glück er in dem Miteinander von Mann und Frau erlebt, hängt heute, neben vielen anderen Faktoren, von seiner ganz persönlichen Haltung und Einstellung ab.
Hierin liegt nun allerdings wiederum ein weiteres beunruhigendes Element. Jahrhundertelang waren im Einflußbereich des Christentums Haltung und Einstellung zur Sexualität durch bestimmte Verhaltensmuster der Triebregulierung oder des totalen Triebverzichtes vorgegeben. Deren Einhaltung wurde mit vielfältigen Sanktionen geschützt. Zeitliche und ewige Strafen bedrohten diejenigen, die sich außerhalb der Ordnung stellten. Der höchste Lohn aber winkte denen, die sich zur sexuellen Enthaltsamkeit verpflichtet hatten. Die sexuelle Lust erschien auf diese Weise als Hauptquelle der Sünde und des Ungehorsams gegenüber Gott. Auf diesem Hintergrund wird ver-
198
ständlich, warum gerade der Wandlungsprozeß im Sexualverhalten zusätzliche Beunruhigungen schafft. Von keinem anderen Bereich menschlichen Lebens und Zusammenlebens wird der einzelne so unmittelbar betroffen, und für keinen Bereich waren die verhaltensregulierenden Normen in der Vergangenheit so unmittelbar mit den Vorstellungen von Sünde und Ungehorsam gegen Gottes Gebote verbunden. Die Revolution der Moral, die unser gesamtes Zusammenleben ergriffen hat, wird so in den Augen vieler Menschen, gerade auch besorgter Christen, eingeengt zur sexuellen Revolution.
Andererseits hängt die Realisierung der Hoffnung auf einen neuen Menschen zu einem großen Teil tatsächlich davon ab, ob es dem Menschen gelingt, mit seinen Trieben - in erster Linie eben mit der Sexualität, aber auch mit der Aggression - anders fertig zu werden als durch Verbieten und Verdrängen und sein Zusammenleben in Ehe und Familie entsprechend zu gestalten. Darum sollen diese Themenkreise im Mittelpunkt der weiteren Erörterung stehen. Die neutestamentlichen Aussagen von der Freiheit, Unbefangenheit und Sachlichkeit des neuen Menschen sind grundsätzlich nicht zu überbieten. Im Gegenteil, nach ihrer jahrhundertelangen Leugnung erscheint dieses Angebot in der Wirklichkeit unserer Tage in einem ganz neuen Licht. Im einzelnen jedoch muß sich zeigen, wieweit wir bereit sind, überlieferte Vorstellungen von Sexualität, Ehe und Familie aufzugeben, um in der Zukunft lebensfähig zu bleiben. Genauso unbefangen gilt es jedoch, moderne Vorstellungen zu prüfen und in Frage zu stellen, ehe sie als Programm für eine bessere Zukunft verkündet werden.
Umgang mit den Trieben
Zu den Vorstellungen, die es zu prüfen gilt, gehören die Haltung gegenüber den menschlichen Trieben, deren Bewertung und die praktischen Konsequenzen, die daraus gezogen werden. In den vergangenen Jahrhunderten wurde die Triebwelt vornehmlich als Sitz des Bösen und Keim der Sünde angesehen. Das galt besonders für die Sexualität und die Aggression des Menschen, die man deshalb durch Verbote zu unterdrücken suchte. Heute sehen viele in dieser Unterdrückung die Ursache für gefährliche Fehlentwicklungen unserer westlich-abendländischen Kultur. Die Liste der zum Teil lebensbedrohenden Folgen der Triebunterdrückung umfaßt die Entstehung und Verschärfung patriarchalischer Strukturen bis hin zu den faschistischen und stalinistischen Diktaturen dieses Jahrhunderts und der sie tragenden Untertanengesinnung ebenso wie die sich wiederholenden Aus-
199
brüche zerstörerischer Wut und fanatischer Vernichtung von Gegnern innerhalb und außerhalb des eigenen Landes. Man kann hier an die Kreuzzüge und Religionskriege der Vergangenheit denken, an die Ketzer- und Hexenverbrennungen, an die Kriege zwischen Nationen und Machtblöcken der Gegenwart, an Juden-, Neger- und Kommunistenjagden und mag schauernd in die Zukunft blicken angesichts der gesteigerten Möglichkeiten der Vernichtung.
Auf Grund dieser Erfahrungen der Vergangenheit erwarten viele das Heil heute von einer völligen Freisetzung der Triebe. Bei ihnen herrscht die Tendenz vor, als natürliches Verhalten des Menschen anzusehen, was man auch bei den Tieren als natürliches Sexual- und Aggressionsverhalten beobachten kann. Ein solches natürliches Verhalten sei automatisch als gut zu beurteilen und dürfe keineswegs als böse oder sündhaft bezeichnet werden. Diese Einstellung ist als Gegenschlag gegen die Haltung vergangener Jahrhunderte zu verstehen. Sie erklärt auch so mißverständliche, affektgeladene Buchtitel wie „Das sogenannte Böse" von Konrad Lorenz oder „Sind wir Sünder?" von Wolfgang Wickler, die der sachlichen Auseinandersetzung wenig dienlich sind. Solche Formulierungen verstärken vielmehr die volkstümlichen Mißverständnisse wissenschaftlicher Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Verhaltensforschung ebenso wie aus den Bereichen der Psychoanalyse - hier wäre der mißverstandene Freud zu nennen - und der empirischen Sozialforschung von Kinsey bis Giese.
Eine biologistische Auffassung der menschlichen Triebe vermag in der Sexualität nicht mehr zu sehen als einen menschlichen Trieb, wie Hunger und Durst, der auf Befriedigung drängt. Das folgende Zitat aus einer Schülerzeitschrift mag dies verdeutlichen. Dort heißt es: „Ihre Interessen, Schülerinnen und Schüler, sind mit Recht dort, wo sich der Körper meldet, nämlich bei Ihrem Unterleib .... Räumen Sie Reck und Schwebebalken, Kisten und Kasten, kurz alle jene Kastrations- und Entjungferungswerkzeuge aus der Turnhalle, und lassen Sie als einziges zurück Decken und Matten, auf die Sie sich paarweise ausstrecken, um Liebe zu machen."
Bekannt wurden auch die Äußerungen einer Hamburger Schülerzeitung: „Meinst du, ein Biologielehrer hätte einen Penis an die Tafel gemalt und dran geschrieben, wie die Einzelheiten bezeichnet werden, welche Funktionen ihnen zukommen? Da lernt man stumpfsinnig, wie die Einzeller alle heißen, und weiß noch nicht einmal, wie ein weibliches Geschlechtsteil aussieht, bevor man nicht selber nachgesehen hat."
Hinter dieser kraftvollen sexuellen Protestsprache der Jugend steckt mehr als der Wunsch nach sexueller Freizügigkeit einschließlich entsprechender Übungsräume in den Schulen. Hier wird die Sexualität vielmehr als Hebel
200
eingesetzt, um die politische Stagnation der westlichen Demokratien zu überwinden und die Emanzipation voranzutreiben.
Darin liegt eine unbezweifelbare Berechtigung der dargestellten Haltung und angesichts der an Politik und Öffentlichkeit weithin uninteressierten Erwachsenen auch ein erfolgversprechender Ansatz; denn auf den Protest an dieser Stelle wird am ehesten und heftigsten reagiert. Diese Feststellung enthebt uns allerdings nicht der Kritik an der biologistischen Auffassung der menschlichen Triebe, die dieser an sich zu begrüßenden Protestbewegung zugrunde liegt. Eine als Mittel zum Zweck eingesetzte, rein biologisch verstandene Sexualität kann dem Menschen nur die Illusion von Befreiung geben. Sie bringt ihn in Wirklichkeit in eine andere Form von Abhängigkeit. Die personbezogene Befreiung von Triebunterdrückung und -Verdrängung muß auf einem anderen Wege gesucht werden.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf einige Ergebnisse der neueren anthropologischen Forschung einzugehen. Diese hat uns darauf hingewiesen, daß der Mensch - allein auf seine Triebe und Instinkte angewiesen - bei seiner Geburt das hilfloseste Geschöpf ist. Während alle anderen Lebewesen mit einem umfassenden Instinktapparat ausgerüstet sind, der sie sicher durchs Leben geleitet, ist der Mensch total verunsichert. Das Fehlen der Instinkte und die Unspezialisiertheit seiner Organausstattung zwingen ihn daher zu intelligenter Umweltergreifung und Umweltgestaltung. Dem Menschen fehlt ein unmittelbares Verhältnis zur Natur, d. h. zu seiner eigenen Natur und zur Natur um ihn herum. Statt dessen baut er sich selber eine Kultur auf, bzw. der einzelne wird auf irgendeiner Stufe einer bestimmten Kultur in diese hineingeboren und nimmt sie im Laufe seines Lebens immer stärker auf, um dann auch in ihren Weiterbau und Aufbau selber gestaltend einzugreifen. Die Kultur schiebt sich also zwischen den Menschen und die Natur, die Kultur wird gewissermaßen zur „zweiten Natur" des Menschen. Danach kann das Wort „natürlich" für den Menschen im Grunde nur in Anführungsstrichen gebraucht werden, und es müßte eigentlich „kultürlich" heißen.
Jeder Mensch, der in früher und frühester Kindheit von seiner Kultur getrennt wird, erfährt starke Schädigungen seiner Personstruktur. Ja, er kann zu einer untermenschlichen Existenz verkümmern oder gar sterben. Dies bezeugen übereinstimmend alle Beobachtungen und Untersuchungen über eine teilweise oder vollständige Isolierung des Menschen im Säuglingsund Kleinkindalter, die in Deutschland besonders von Rene A. Spitz unternommen wurden.
Solche Entwicklungsstörungen, wie Sprachschwierigkeiten, spätes Laufenlernen, lange Unsauberkeit und Unfähigkeit zur selb-
201
ständigen Nahrungsaufnahme, können bereits in Krankenhäusern oder Kinderheimen auftreten, in denen die Anzahl der Pflegepersonen im Verhältnis zur Kinderzahl zu gering ist. Von daher werden die hier angedeuteten Erscheinungen auch Hospitalismus genannt.
Das wichtigste Instrument der menschlichen Kultur zur Überwindung der Instinktunsicherheit sind soziologisch gesehen die Normen. Der amerikanische Soziologe Robert Bierstedt definiert sie als Spielregeln des gesellschaftlichen Lebens. Die Normen regeln das Miteinander der Menschen in optimaler Weise, d. h. sie werden zwar niemals von allen vollständig eingehalten, zugleich aber bewahren sie die Menschen vor chaotischer Beliebigkeit und sichern damit den Bestand der Kultur. Diese Spielregeln machen menschliches Zusammenleben überhaupt erst möglich. Sie sind also lebensnotwendig, „weil dem Menschen die angeborene Anpassung des Tieres an seine Umwelt fehlt" (Gehlen, Forschung 21).
Weil der Mensch darauf angewiesen ist, seine Umwelt als Lernender und Handelnder zu ergreifen, braucht er die Normen als „Kulturfahrplan" seines Lebens, der an die Stelle des „Instinktfahrplanes" oder „Naturfahrplanes" der Tiere treten muß. Was bedeuten diese allgemeinen Aussagen für die Geschlechtlichkeit des Menschen? Instinktunsicherheit und Unspezialisiertheit der menschlichen Organausstattung heißt auf diesem Gebiet zweierlei. Zum ersten fehlt dem Menschen die instinktive Steuerung seines Geschlechtslebens. Während das Tier an bestimmte Perioden, Brunst- und Paarungszeiten bei Männchen und Weibchen gebunden ist, kann der Mensch den Geschlechtsakt praktisch zu jeder Zeit ausüben. Sobald er geschlechtsreif ist, sind Potenz und Koitusbereitschaft nicht mehr zeitlich gebunden. Die Instinktunsicherheit wird durch einen ständigen Antriebsüberschuß noch vergrößert. Die menschliche Natur sagt dem Menschen also zu keiner Zeit, wann er den Akt zu vollziehen hat und wann er es nicht darf. Es ist vielmehr die Aufgabe der Kultur, diese Instinktunsicherheit durch Normen zu kanalisieren und den Menschen von ihr zu entlasten.
Die Unspezialisiertheit der menschlichen Organausstattung bedeutet zum zweiten, daß die Geschlechtlichkeit des Menschen nicht eindeutig dem Ziel der Fortpflanzung und Arterhaltung zu dienen hat, sondern auch der menschlichen Lustbefriedigung und Daseinsüberhöhung. Beide Ziele sind nebeneinander und voneinander getrennt möglich. Dieser zweite Wesenszug menschlicher Sexualität erhöht die Gefahr der Allgeschlechtlichkeit und sexuellen Freizügigkeit des Menschen um ein weiteres.
Will der Mensch sich nicht in einer Pseudonatürlichkeit primitiver Naturstufen verlieren, ist er darauf angewiesen, seine natürliche Unsicherheit auf geschlechtlichem Gebiet
202
kulturell zu überwinden und in Verhaltenssicherheit umzuwandeln. Die Frage ist allerdings, wie das geschehen kann, ohne daß es zur Triebunterdrückung und -verdrängung kommt.
An dieser Stelle ist der Protest gegen die Einstellung zu den menschlichen Trieben, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten vorherrschte, sachgemäß. So leugnet auch Herbert Marcuse nicht, daß die Meisterung der Libido und die Kanalisierung der Sexualität die Kulturleistung des Menschen geboren haben, aber er sagt, es sei auf diese Weise nur eine ganz bestimmte Kultur, eine ganz bestimmte Form des Zusammenlebens von Menschen, eben die patriarchalisch, autoritär geordnete Struktur der Gesellschaft, entstanden.
Die Gegenwart ist in seinen Augen nicht durch eine allmähliche Überwindung dieser patriarchalischen, autoritären Strukturen gekennzeichnet, sondern an die Stelle der Väter seien das Management, die Organisation, die technische Zivilisation getreten, die das Ausmaß der Unterdrückung und Repression der Menschen, den Zwang zur Leistung nicht gelockert, sondern erschwert, verschärft und vertieft haben. Marcuse entwirft deshalb das Gegenmodell einer nicht repressiven Kultur, das Bild einer Gesellschaft, in der Lust und Freiheit, Trieb und Moral miteinander versöhnt werden, in der die Arbeit sich zum Spiel wandelt.
Ob die Hoffnung auf einen neuen Menschen, der in dieser spielerischen Weise sein Leben meistern kann, in Erfüllung geht, hängt noch stärker als von der Gestaltung der Sexualität von der Bewältigung der Aggressionsproblematik ab, denn sowohl in der moralischen Verdammung der Sexualität als auch in ihrer biologistischen Verherrlichung sind verdeckte Aggressionen verborgen. Es ist also zu einfach, das Entstehen von Aggressionen lediglich auf die Unterdrückung der Sexualität oder auf Frustrationen überhaupt zurückzuführen.
Vorstellungen dieser Art sind in Amerika in der sogenannten Yale-Schule entwickelt worden. Obwohl die Psychoanalytiker, in Deutschland etwa Alexander Mitscherlich, deren Deutung über die Entstehung von Aggressionen kritisch gegenüberstehen, wird sie auch bei uns vertreten. Ein gutes Beispiel für diese Auffassung ist das Buch von Arno Plack (Die Gesellschaft und das Böse). Nach der Frustrations-Aggressions-Theorie setzt der Eintritt von Aggressionen stets die Existenz von Frustrationen voraus. Umgekehrt führt die Existenz von Frustration immer zu irgendeiner Form von Aggression. Unter Frustrationen werden dabei Strebensverhinderungen verstanden. Als Aggressionen werden Handlungen angesehen, deren Ziel es ist, eine Person oder einen Gegenstand anzugreifen.
Die hier referierten Forscher leugnen also einen eigenständigen Aggressionstrieb und halten die Aggression nur für die Reaktion auf Behinderung der Entfaltungsmöglichkeiten
203
der Person, gerade auch auf sexuellem Gebiet. Da diese Hypothese in der amerikanischen Pädagogik zunächst zahlreiche Anhänger fand, hat uns die amerikanische Gesellschaft das Anschauungsmaterial einer Generation von non-frustration-children geliefert, die überraschenderweise wesentlich aggressiver waren als die Gleichaltrigen anderer Gesellschaften bzw. Epochen der amerikanischen Gesellschaft.
Die gegenwärtige Psychoanalyse setzt der Frustrationshypothese die Auffassung entgegen, daß jeder Mensch mit einem gewissen Maß an Aggressionspotential existiert. Es komme nur darauf an, in der frühen Kindheit den gekonnten Umgang mit seinen Aggressionen zu lernen. Sowohl der erzieherische Verzicht auf jede Form der Frustration als auch eine autoritär strenge Erziehung, die jede frühkindliche Aggressionsäußerung zu vereiteln sucht, wirken aggressionssteigernd. Hier sieht Mitscherlich einen entscheidenden negativen Beitrag des Christentums. Er sagt „Nachweisbare unerträgliche und pervertierte Frustrierungen und Einschüchterungen des Kindes als eines „schwächeren Partners" haben die ungekonnte destruktive Aggression in unserer „christlichen" Kultur allgegenwärtig gemacht" (Aggressivität 56).
Mitscherlich und andere unterscheiden heute zwischen gekonnter und ungekonnter bzw. zwischen aufbauend-konstruktiver und zerstörend-destrukti-ver Aggression. In solchen Unterscheidungsversuchen kommt zum Ausdruck, daß die Aggression an sich, wenn sie als Primärtrieb des Menschen verstanden wird, eine wichtige Funktion hat. Aggression in diesem Sinne ist lebensnotwendig, weil der Mensch dadurch erst in Stand gesetzt wird, als Lernender und Umweltergreifender sein Leben zu gestalten. Nur wenn er in der Lage ist, auf seine Mitmenschen zuzugehen, mit Situationen umzugehen, sich anzupassen und zu ändern, aber auch die Welt, in der er lebt, zu verändern, nur dann ist der Mensch lebensfähig. Das lateinische Wort aggredior heißt ja zunächst ganz wertfrei „ich gehe heran". In dieser konstruktiven Form der Aggression findet eine ständige Triebmischung mit den sexuellen Trieben statt. Beide Triebe gemeinsam prägen unseren Umgang mit unseren Mitmenschen und machen ein Zusammenleben von Menschen möglich. Zur destruktiven Aggression kommt es - und hier besteht eine gewisse Nähe zur Frustrationshypothese —, wenn der Mensch in seinem liebevollen Zugehen auf die Welt und die Menschen mit dem Wunsch, sie zu entdecken, zu besitzen und zu ändern, in unangemessener Weise frühzeitig behindert wird. Und wiederum muß man sagen: das ist unter dem Vorzeichen einer christlichen Gesetzesethik in der familiären, schulischen und kirchlichen Erziehung jahrhundertelang geschehen.
Von der christlichen Familie bis zum christlichen Staat herrschte eine patriarchalisch autoritäre
204
Herrschaftsordnung, in der die Kinder und Untertanen dadurch zum Triebverzicht gebracht wurden, daß die Väter selbst für sich das Recht aggressiver Züchtigungsmaßnahmen in Anspruch nahmen. In Identifikation mit Gottvater selbst lebte man guten Gewissens, wenn man „aus Liebe" den Trotz seiner Kinder mit Gewalt brechen zu müssen meinte oder den im Glauben Irrenden dem Ketzergericht und der Inquisition unterwarf. In eine ähnliche Situation wie die Kinder gerieten die Ehefrauen, wenn Bibelzitate einseitig auf sie bezogen wurden. Das gilt insbesondere für einzelne Stücke aus dem Hohen Lied der Liebe (1. Kor. 13), wo es u. a. heißt, die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles, sie duldet alles.
Dieser Text legt das Mißverständnis nahe, als seien Unterwürfigkeit und Verzicht auf Widerstand gegenüber einem patriarchalisch-autoritären Vater und Ehemann christliche Forderungen. Diese unrichtige Vorstellung hat dazu beigetragen, daß Generationen von Frauen in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit behindert wurden. Gleichzeitig bot sich für sie die Gelegenheit eines unbewußten Arrangements: dadurch, daß der stärkere Partner sich dieser Liebesforderung, die ursprünglich nicht die Gattenliebe, sondern die Liebe Jesu meinte, nicht unterwarf, konnte der Schwächere sich als moralisch überlegen erleben. So wurde die Abfuhr von Aggressionen, die sich in der unbewußt widerwilligen Selbstunterwerfung angestaut hatten, ermöglicht. Die oft zu beobachtende masochistische Selbstpeinigung vieler Ehefrauen und Mütter, mit der auch offene oder versteckte sadistische Verhaltensweisen gegenüber den Ehemännern und Kindern verbunden sein können, ist also kein angeborenes Geschlechtsmerkmal der Frau, sondern hängt mit dem dargestellten psychischen Prozeß zusammen. Kürzer gesagt: eine solche Haltung ist nicht wesensmäßig, sondern kulturell bedingt. Neben der anthropologischen Aggressionsforschung ist auch die biologische Verhaltensforschung dem Phänomen der Aggressoin nachgegangen. Am bekanntesten ist das Buch von Konrad Lorenz. Lorenz führt aus, daß der Aggressionstrieb im Tierreich ausschließlich konstruktive, arterhaltende Funktionen habe. Er diene der Zuchtauswahl, ein Gedanke, der bereits bei Darwin aufgetaucht war, der Revierverteilung und -Sicherung, sowie dem Herstellen einer Rangordnung in größeren Verbänden. Weitere Einzelbeobachtungen weisen darauf hin, daß der Aggressionstrieb bei vielen Tieren nur mit dem Sexualtrieb zusammen auftritt und ohne Aggression weder eine Paarung noch eine Tierfreundschaft möglich ist. Innerhalb der gleichen Art wirkt der Aggressionstrieb in der Regel nicht tötend, weil im entscheidenden Moment der Niederlage des Schwächeren bei dem Stärkeren eine instinktive Tötungshemmung eintritt, wenn der Unterlegene dem Sieger seine schwächste Stelle zum Gnadenstoß anbietet.
205
Lorenz meint, bei dem Werkzeug- und waffenlosen Menschen habe dieser Instinktmechanismus auch noch funktioniert, aber in dem Maße, wie immer kompliziertere Werkzeuge und Waffen zwischen den Aggressor und sein Objekt traten, sei die Tötungshemmung zurückgegangen, und in der Gegenwart mit ihren gewaltigen Waffensystemen, die nur noch anonym wirken, sei dieser Instinkt völlig erloschen. Von daher fordert auch er, daß wir den Umgang mit unseren Aggressionen neu lernen müssen, wenn die Menschheit sich nicht in absehbarer Zeit total vernichten soll. Seine Vorschläge decken sich zum Teil mit denen der anthropologischen Forschung insofern, als auch er die non-frustration-Methode und die verbotsmäßige Unterdrückung als unbrauchbar ablehnt. Auf solche Weise werde die Aggression nur gesteigert. Auch die Verringerung durch Medikamente oder durch Änderung der Erbanlagen lehnt er ab, weil eine allgemeine Lebensschwäche und Unfähigkeit zur Daseinsbewältigung die unausweichlichen Folgen wären.
Als mögliche Wege des Umgangs mit Aggressionen dagegen sieht Lorenz die Wahl von Ersatzobjekten an: die Sublimierung oder Ritualisierung in Spiel und Sport etwa, das Kennenlernen der Gegner, um aggressionssteigernde Vorurteile abbauen zu können, und schließlich die Umpolung der nationalen oder weltanschaulichen Begeisterung zur weltbürgerlichen Gesinnung. Die Brauchbarkeit der einzelnen Vorschläge wäre zu prüfen. Lorenz selbst ist gegenüber der menschlichen Vernunft, die nach solchen Auswegen suchen muß, skeptisch, aber er vertraut auf „die großen Konstrukteure des Artenwandels", Mutation und Selektion, die immer wieder neue Lebensformen hervorbringen, daß sie auch dem Menschen die notwendige Anpassung an die „neue Situation" ermöglichen (Böse 387).
Spätestens an dieser Stelle macht sich der Biologe einer unzulässigen Grenzüberschreitung schuldig. Andere Biologen, wie etwa Adolf Portmann, weisen ja gerade darauf hin, daß ein entscheidender Unterschied zwischen Mensch und Tier in der generellen Instinktunsicherheit besteht. Diese ist also nicht auf die Tötungshemmung beim Aggressionstrieb beschränkt. Sie gilt ebenso für das Problem der Ernährung der Weltbevölkerung. Der Eßzwang, der in unserer Gesellschaft vielfach, vor allem auf Kinder ausgeübt wird, macht die Problematik des Ernährens im Kleinen ebenso deutlich, wie dies im Großen in der bisherigen Unfähigkeit zu sinnvoller Verteilung von Nahrungsmitteln gilt. Wir können uns nicht auf „die großen Konstrukteure des Artenwandels" verlassen, sondern wir müssen unsere vernünftigen Möglichkeiten nutzen, um menschenwürdige Lebensbedingungen zu entwickeln.
206
Für das Problem des Umgangs mit den Trieben bedeutet dies, daß sowohl die bisher geforderte verdrängende Einstellung abgelöst werden muß als auch das bloße Gewährenlassen einer vermeintlichen Natürlichkeit. Zum neuen Menschen gehört der Mut zur Wahrnehmung der körperlichen und seelischen Realität im einzelnen Menschen wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Erst auf dieser Basis ist unbefangene Kommunikation und sachliche Verständigung möglich, unabhängig von einer konservativen oder progressiven Ideologie, der man verpflichtet ist, und von der Übermacht der eigenen Triebe, denen man willenlos ausgeliefert ist. Tiefenpsychologisch gesprochen heißt das: der neue Mensch, auf den sich die Hoffnung richtet, wird nicht mehr vorwiegend über-ich- bzw. es-bestimmt sein, sondern von einem entscheidungsfähigen Ich gesteuert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, sich über die Sozialisation und Erziehung des Menschen Gedanken zu machen.
Sozialisation und Erziehung ohne Angst
Unter Sozialisation versteht man in der Soziologie zunächst ganz allgemein den Prozeß des Hineinwachsens in die Gesellschaft; genauer gesagt: den Vorgang der Aneignung der kulturellen Werte, der Annahme der gesellschaftlichen Normen und Rollen und der Befähigung zum Umgang mit den materiellen Gegebenheiten der jeweiligen Gesellschaft. Dabei ist weniger an einen Vorgang der Vergesellschaftung oder Entpersonalisierung des Individuums zu denken, als vielmehr an eine personspezifische Verarbeitung der gesellschaftlichen Erwartungen und entsprechende Rückwirkungen auf die Gesellschaft.
Je differenzierter eine Gesellschaft strukturiert ist, desto länger dauert dieser Prozeß. In unserer eigenen Gesellschaft, die einem schnellen sozialen Wandel unterliegt und von ihren Gliedern noch bis ins Alter hinein die Auseinandersetzung mit gewandelten Wertvorstellungen, die Übernahme neuer Rollen und die Bewältigung fortschreitender Technik erwartet, dauert der Sozialisationsprozeß prinzipiell lebenslang. Die Erziehung muß diese Tatsache berücksichtigen und bereits in der Kindheit Hilfestellung für den Prozeß des Erwachsenwerdens geben. Da die jetzige Elterngeneration selbst kaum solche bewußte Hilfe erfuhr, kann für sie Angst entstehen; aber diese Schwierigkeit ist nicht durch Ausweichen zu beheben, sondern nur dadurch, daß ihre Realität gesehen wird. Eltern, Kinder und Jugendliche befinden sich hier in der gleichen Situation, daß sie nämlich lernen müssen, Mut für die persönliche und soziale Weiterentwicklung einzusetzen.
207
In unserer Gesellschaft gibt es für den Menschen nur noch ausnahmsweise einen klar vorgezeichneten Weg zu einem ebenso klaren Ziel. Die Regel ist vielmehr, daß sich im Laufe des Lebens immer wieder neue Möglichkeiten persönlicher Entscheidung und Notwendigkeiten beruflicher Neuorientierung zeigen. Mit der Entscheidungsnotwendigkeit ergibt sich aber auch das Risiko einer falschen Entscheidung. Wer so aufgewachsen ist, daß er nur dann vor sich und anderen bestehen kann, wenn er das, was er leisten soll, bereits weiß und kann, der wird sich gegen die Zumutung von lebenslangem Lernen und Sichumstellen wehren, weil er als Lernender vorübergehend wieder in Abhängigkeit und Unsicherheit gerät, und dies entspricht nicht dem traditionellen Bild vom Erwachsensein.
Wir müssen aber heute davon ausgehen, daß die psychosoziale Entwicklung des Menschen ein lebenslanger Prozeß ist. Das sach- und persongemäße Umgehen mit neuen Realitäten stellt sich als Aufgabe z. B. für Kinder nach einem Wohnortwechsel, für Jugendliche beim Eintritt in die Berufsausbildung, für Eltern mit dem Erwachsenwerden der Kinder, für ältere Menschen mit dem Nachlassen der physischen Kräfte. In solchen Situationen reicht eine allgemeine äußerlich-organisatorische Anpassung nicht aus. Es muß vielmehr jeweils das Besondere erfaßt und ihm entsprechend das Leben gestaltet werden: die Möglichkeiten der neuen Umgebung, Kontaktangebote der Kollegen, vermehrte Zeit zu eigener Verfügung, die Chance eines ruhigeren Tagesablaufes. Trotz allen Veränderungen besteht auch in unserer Gesellschaft die Erwartung, daß die jeweiligen Rollen übernommen werden. Im Gegensatz zur statischen Gesellschaft ist aber die dynamische offen genug, um - wenn auch langsam - ihre Erwartungen entsprechend den Lebensformen, die als konstruktiv erfahren werden, zu ändern. Dies schlägt sich z. B. in Gesetzesänderungen nieder. Die Ordnung unserer Gesellschaft ist nicht heilig, so daß sie nicht in Frage gestellt werden dürfe, sondern sie ist von ihren Gliedern zu gestalten und soll menschenwürdiges Leben ermöglichen. Um diesen Zweck zu erfüllen, muß sie sich an den sich wandelnden Lebensnotwendigkeiten orientieren. Lärm- und Schmutzbekämpfung zum Beispiel sind neue Aufgaben. Sie können nur von Menschen bewältigt werden, die sich nicht hinter dem, was schon immer war und galt, verschanzen müssen. Auf die junge Generation werden in größerem Umfange und Tempo ständig neue Aufgaben zukommen. Darum muß Erziehung den Menschen fähig machen zu sachlich angemessenem Umgang mit der Wirklichkeit.
Dieses Ziel kann nicht ohne Folgen bleiben für die Erziehungsstile. Während die Erziehung früher weitgehend so verlaufen konnte und auch verlief, daß der Erwachsene die Zielform darstellte, Kinder und Jugendliche
208
sich also mit dem Erzieher früh und bleibend identifizieren konnten, ist heute eine gemeinsame Orientierung am jeweiligen Sachverhalt erforderlich, um die Fähigkeit zu eigenständigen Problemlösungen zu entwickeln. Das bedeutet, daß nicht nur die Beziehung zwischen Erwachsenen einerseits und Kindern und Jugendlichen andererseits, sondern auch die beider zu der jeweiligen Aufgabe bzw. Situation reflektiert werden muß. Der Erzieher muß dem jungen Menschen helfen, Hoffnung zu behalten, damit dieser ausreichend positive Erfahrungen bei seinen Bemühungen machen kann - vom Greifen über das Bauen mit Klötzen, zum Erledigen von Schularbeiten und Gestalten erster Kontakte mit dem anderen Geschlecht. In diesen und anderen Situationen wirkt die eigene Einstellung des Erziehers ermutigend bzw. entmutigend. Außerdem kann aber durch zu geringe Selbstreflexion des Erziehers bei diesem zum Beispiel ein Sichangegriffenfühlen oder Beleidigtsein entstehen, die ihn zu aggressivem und damit angstmachendem Reagieren veranlassen. Wiederholen sich solche Abläufe, in denen die Bearbeitung des Sachverhaltes behindert wird durch persönliche Konfrontation, ergibt sich die Frage, welche Schwierigkeiten der Erzieher im Umgang mit sich selbst und anderen nicht wahrnimmt.
Erzieher, die zu Ermahnungen, Vorschlägen und drängendem Zureden neigen, übersehen häufig, daß auf diese Weise dem Kind nicht geholfen werden kann, weil ihm keine Hilfestellung zur eigenen Bewältigung gegeben, sondern eine stellvertretende Lösung durch den Erwachsenen angeboten wird. Hinzu kommt das Problem der Ungeduld des Erziehers, der dem Kind oft nicht den zeitlichen Spielraum läßt, den dieses seinem Rhythmus entsprechend benötigt. So macht das Kind erste Erfahrungen von Unfähigkeit nicht in einer Aufgabenstellung, sondern in der Beziehung zu den lebenswichtigen Personen. Frühkindliche Entmutigung führt nicht selten zur Angst vor dem Größerwerden und damit vor dem Leben überhaupt. Eine weitere Behinderung des sachgemäßen und aufgaben- bzw. situations-bezogenen Umgangs von Erwachsenen und Heranwachsenden ist die Tendenz, Kinder und Jugendliche auf die Zukunft zu vertrösten, wenn auftretende Wünsche in der Gegenwart nicht erfüllt werden können oder sollen. Dabei wäre jedoch zu fragen, welcher Art diese Wünsche eigentlich seien, ob sie ein engeres oder weiteres Leben zum Inhalt haben, ob sie nur dem Genießen und der Bequemlichkeit gelten oder auch eigener Aktivität und Gestaltung.
In der Erziehung entsteht diese Tendenz zu vertrösten leicht, weil sie einerseits dem Altersgefälle vom Erwachsenen zum Kind entspricht und andererseits die Möglichkeit zu bieten scheint, die Unbequemlichkeiten der Versorgung von kleinen Kindern schneller loszuwerden.
Dabei ist erwiesen, daß
209
das Herausstreichen zu gewinnender Privilegien nur dann anspornend wirkt, wenn der Weg dorthin als realisierbar erlebt wird.
Wenn mit eigenem Geld zunächst kleine Wünsche erfüllt werden können, wächst allmählich der Mut, für größere zu sparen. Ebenso zeigt die Erfahrung, daß Kinder, die mit allem Anfangsungeschick doch selbst tätig werden dürfen, von sich aus ihren Weg zu praktischer Selbständigkeit und Verantwortung finden. Die Behinderung eigener Aktivität einschließlich erheblichen Risikos verlängert dagegen die Unselbständigkeit und damit auch die Anfälligkeit für Ängste, die aus psychischer Schwäche entstehen.
Der Zusammenhang von Angst einerseits und Aktivität oder Aggression andererseits ist zwar seit langem bekannt und auch durch die Verhaltensforschung nachdrücklich bestätigt - im Totstellreflex etwa erfolgt durch Angst eine totale Blockierung der Aktivität -, aber bisher wurden wenig Konsequenzen aus dem vorhandenen Wissen gezogen. Die letzten Jahre der gesellschaftlichen Entwicklung zeigen in vielen Ländern die gleichen Symptome: Angst und destruktive Aggressivität als Reaktion auf die überall spürbaren Notwendigkeiten von Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung kann im Großen wie im Kleinen nur dann gelingen, wenn statt Angst und Destruk-tivität gestaltende konstruktive Impulse vorhanden sind und wirksam werden. Und hier erweist es sich zur Zeit noch als verhängnisvoll, daß in der Vergangenheit das brave, stille Kind - „man hört es gar nicht" - weithin als Ideal angesehen wurde. Solche Kinder hatten auf eigene altersgemäße Aktivität weitgehend verzichtet und sich den Erwartungen der Erwachsenen angepaßt. So konnten sie nicht lernen, verändernde Aktivität zu entfalten. Die menschlichen Fähigkeiten zu Weltentdeckung und -Veränderung, Wandlungs- und Risikobereitschaft wurden zu schwach entwickelt und können nun oft nur ungekonnt zum Ausdruck gelangen. Die damit häufig gleichzeitig erlebte Unsicherheit und Angst vermehren das Ungeschick. Fortgesetzte Behinderung, vor allem der kindlichen expansiven und aktiven Impulse, wird zu vermehrter Destruktion und Angst führen. Es steht nicht mehr in unserem Belieben, solche Zusammenhänge zu berücksichtigen oder nicht. Die unausweichlich anstehende gesellschaftliche Weiterentwicklung ist in hohem Maße von der Erziehung abhängig.
Obwohl seit Jahrzehnten viele Erkenntnisse gesammelt werden über das, was sich für menschliche Existenz und Entwicklung zuträglich bzw. schädlich auswirkt, blieb in der Erziehung nach wie vor das Übergewicht von Verbieten, Befehlen und Strafen gegenüber dem Ermöglichen, Beraten und Loben erhalten. Von Kindheit an wird so die Abhängigkeit von machtbesitzender Autorität weitgehend als selbstverständlich erlebt. Dies bedeutet, daß sich eine Haltung entwickelt, in der man Orientierung, Initiative und
210
Entscheidung von anderen Menschen erwartet. Entwicklung erfolgt dann in Anpassung an die von außen gesetzten Normen und Notwendigkeiten, die sich aber in unserer dynamischen Gesellschaft ständig wandeln. Menschen, die keine ausreichende Entscheidungsfähigkeit entwickeln konnten, werden durch gesellschaftliche Wandlung getrieben und geängstigt, da die neuen Situationen von ihnen immer neue Umstellung fordern, zu der sie sich jedoch nicht selbst entscheiden können. Die soziale Lebensfähigkeit erweist sich als abhängig von Entscheidungs- und Umstellfähigkeit. Diese Fähigkeit wurde bisher nur ausnahmsweise in der Kindererziehung gefördert. Heranwachsende und Erwachsene sehen sich daher heute vor der Aufgabe, diesen Mangel zu beheben. Darin liegt nicht nur eine Frage nach den geeigneten Erziehungsmethoden, sondern auch nach den Formen des Zusammenlebens, in denen die Erziehung erfolgt.
Neue Formen des Zusammenlebens
Über Jahrtausende hinweg stellte die Familie den entscheidenden Rahmen dar, in dem das Miteinander von Männern und Frauen sich gestaltete. Hier waren ihre Beziehungen als Ehegatten oder Geschwister, als Mutter und Sohn, als Vater und Tochter und als Verwandte im weiteren Sinne eindeutig festgelegt. Alle sexuellen Normen, die uns überliefert sind, gehen von dieser Ordnung aus. In der Wirklichkeit unserer Tage ist der ausschließliche Bezugsrahmen der Familie gesprengt. Männer und Frauen erleben ihr Miteinander in unserer Gesellschaft in vervielfältigter Form als Spielgefährten und Klassenkameraden, als Studienfreunde und Arbeitskollegen, als Vorgesetzte und Untergebene, als Freizeitkonsumenten und Urlaubsgefährten. Die Situationen der Begegnung von Männern und Frauen sind damit gegenüber früher viel zahlreicher geworden. Wir alle erleben sie nebeneinander und nacheinander in einem ständigen Rollenwechsel, in einem lebenslangen Prozeß des Reifens und Älterwerdens, der uns ebenfalls von einer Rolle in die andere führt. Und wir erleben diese Situationen als einzelne, gleichgültig, ob wir verheiratet oder unverheiratet, noch nicht verheiratet, geschieden oder verwitwet sind. Der Familienstand gibt außerhalb des eigenen familiären Bezugsrahmens keine Verhaltenssicherheit mehr.
Der neue Sachverhalt wird ganz anschaulich, wenn man sich am Wochenende oder im Urlaub einmal die Zeit nimmt, in einer abgeschiedenen, ländlichen Gegend einen Gottesdienst zu besuchen.
211
Wenn man Glück hat, kann man dort noch einmal erleben, wie Männer und Frauen nach Alter, Geschlecht, Familienstand und Familienzugehörigkeit, unter Umständen sogar noch in ihrer jeweiligen Tracht, auf den für sie vorgesehenen und seit Generationen angestammten Plätzen sitzen. Demgegenüber stelle man sich die Sitzordnung in einem Kino oder Theater vor, in einer Fertigungshalle oder einem Bürosaal, und man wird gewahr, welcher Wandel der Realität hier gemeint ist.
In einer Zeit, in der verheiratete und unverheiratete Männer und Frauen sich in vielen Rollen zwischengeschlechtlicher Partnerschaft begegnen, reicht das nach Auflösung der Großfamilie einzig übrig gebliebene Leitbild „Mann + Frau = Ehe" nicht mehr aus, um Verhaltenssicherheit zu vermitteln. Im Gegenteil, es wirkt in weiten Bereichen unseres Zusammenlebens verunsichernd, weil eine geglückte Partnerbeziehung in einem nichtfamiliären Bereich, am Arbeitsplatz etwa, von den Beteiligten selber wie von Dritten oft sehr schnell als Bedrohung der Ehe empfunden wird, wenn einer der beiden Partner oder auch beide verheiratet ist bzw. sind. Solange die Ehe das einzige anerkannte Modell mann-fraulicher Beziehungen bleibt, in dem Zuneigung und Verstehen, volles gegenseitiges Vertrauen und Verläßlichkeit aufeinander möglich sind, gerät jede andere Beziehung zwangsläufig in den Verdacht, sich auf Ehe hin zu entwickeln oder mit Ehe konkurrieren zu wollen.
Unter der Diskrepanz zwischen Leitbild und Wirklichkeit haben im Augenblick besonders die Ledigen und Alleinstehenden in unserer Gesellschaft zu leiden. Diese Gruppe ist zwar immer kleiner geworden, wenn man bedenkt, daß heute die Hälfte unserer Bevölkerung verheiratet ist, während es noch 1871 ein Drittel und bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts oft nur ein Viertel war.
Die große Gruppe der Unverheirateten war aber in der Vergangenheit nicht heimatlos, sondern vielfunktional in die Familie ihres Elternhauses oder ihrer Herrschaft eingebunden und versorgt, so unbefriedigend diese Lösung für viele im einzelnen auch gewesen sein mag. In unserer Zeit hat sich ihre Lage in mancher Hinsicht erschwert. Der unverheiratete Erwachsene ist heute einfach nicht mehr vorgesehen. Die moderne Zwei-Generationen-Kleinfamilie bietet den unverheirateten Verwandten keine Heimat. Ebensowenig gehört heute die große Herrschaft mit einer zahlreichen ledigen Dienerschaft noch zur Regel. Und in der sachlichen Kühle und Distanz der industriellen Arbeitswelt mit ihrer terminierten Arbeitszeit kann der ledige Mensch ebenfalls nicht das Gefühl ganzheitlicher Geborgenheit gewinnen. Die Erotisierung mancher Berufssituationen steht dazu nicht im Widerspruch. Sie ist nur ein zusätzliches Zeichen einer geänderten Gesamtlage und zeigt den Unverheirateten noch deutlicher ihre Vereinsamung, wenn die
212
Fabriktore und Bürotüren sich hinter ihnen schließen und der Feierabend oder das lange Wochenende vor ihnen liegen.
Angesichts dieser gewandelten Realität verdienen die neuen Versuche, groß-familienähnliche Strukturen des Zusammenlebens verheirateter Paare und lediger Männer und Frauen mit verwandten Lebensinteressen und Berufsmerkmalen zu erproben, die Aufmerksamkeit christlich-ethischer Reflexion. Daß nach neuen Modellen der Symbiose verheirateter und unverheirateter Menschen gesucht werden muß, die der hochindustrialisierten Gesellschaft genau so angemessen sind, wie die Großfamilie alten Stiles einst der vorindustriellen Gesellschaft, steht außer Frage.
Vielleicht sind solche Modelle leichter zu entwickeln, wenn jeweils mehrere Erwachsene und deren Kinder einen familiär-freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen, als wenn eine Kleinfamilie in entsprechender Weise mit einem Ledigen verbunden ist. Dabei mag die Frage, bis zu welchem Grade die Selbständigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich des selbständigen Wohnens der einzelnen Beteiligten, erhalten bleiben kann, oder ob sie vollständig aufgehoben werden muß, wiederum sehr unterschiedlich gelöst werden. Entscheidend sind die Bereitschaft, füreinander da zu sein, und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die Bedeutung des Geschlechtsverkehrs tritt demgegenüber stark zurück. Er bleibt in der Regel auf die Ehepaare beschränkt und wird eher von den Außenstehenden als von den unmittelbar Beteiligten als Problem empfunden.
Seit einem Jahr liegt eine wissenschaftliche Arbeit von Hermann Schempp vor, in der ein umfassender Überblick über alle uns bekannten Gemeinschaftssiedlungen von den Tagen der Essener, einer vorchristlichen jüdischen Sekte, bis zu den chinesischen Volkskommunen geliefert wird. Auch nach diesem Überblick wurde die Gütergemeinschaft unterschiedlich verwirklicht. Unter den gegenwärtigen Experimenten ist sie in dem israelischen Kibbuzim am umfassendsten verwirklicht. Dort erstreckt sie sich vielfach auch auf die Dinge des persönlichen Bedarfs. Die sozialistischen Gemeinschaftsformen in Rußland und China haben dagegen meist nur die Produktionsmittel vergesellschaftet.
Das Familienleben war ebenfalls sehr uneinheitlich gestaltet. In der Gegenwart überwog die Einehe bis hin zur Vorschrift, daß jedes erwachsene Mitglied der Wohngemeinschaft verheiratet sein müsse. Es gab aber auch Gemeinschaften, in denen die Ehelosigkeit für Männer und Frauen gefordert wurde und Kinder nur adoptiert werden konnten. Die Polygamie bei den Mormonen dagegen war eine Ausnahme. Freie Liebesbeziehungen waren vor allem in den Gründerjahren sozialistischer Gemeinschaftssiedlungen häufiger. Auch in den Kibbuzim hatte man anfänglich versucht, ohne die „bürgerliche Ehe" auszukommen.
213
Aber die Tendenz geht überall dahin, innerhalb der größeren Gemeinschaften an der Kleinfamilie als inneren Kern festzuhalten. Schempp schreibt dazu: „Offenbar können weder durch hohen Idealismus noch durch Zwang auf die Dauer die emotionalen Bindungen an den Ehepartner und an die eigenen Kinder aufgehoben werden" (Gemeinschaftssiedlungen 287).
In der Gegenwart haben wir keinen Grund, den Egoismus der Kleinfamilie zu verteidigen gegenüber Versuchen, neue Formen des Zusammenlebens zu erproben, die einen Teil der Funktionen der alten Großfamilie übernehmen könnten.
Vor allem für die heranwachsenden Kinder vom dritten Lebensjahr an können Erfahrungen in größeren Lebensgemeinschaften wichtig werden. In dieser Zeit, in der phallischen oder ödipalen Phase, wenn in Begegnung und Auseinandersetzung mit gleich- und gegengeschlechtlichen Pflegepersonen die Grundlagen für die Annahme der eigenen Geschlechtsrolle als Mann oder Frau gelegt und der Umgang mit den aggressiven und libidiösen Triebregungen eingeübt wird, erscheint es fraglich, ob die Sozialisationserfahrungen in der heutigen Zwei-Generationen-Kleinfamilie ausreichen, um die Lebenstüchtigkeit zu vermitteln, die der Mensch in unserer Gesellschaft benötigt. In der Familie erleben die Kinder ihre erwachsenen männlichen und weiblichen Bezugspersonen ausschließlich als Vater und Mutter. Dadurch werden das erwachsene Mann- und Frausein in einem so starken Maße mit Vaterschaft und Mutterschaft, die zwischengeschlechtliche Partnerschaft Erwachsener mit Ehe identifiziert, daß die Existenz des Ledigen und kinderlosen Erwachsenen später nur als defizien-ter Zustand und die nichteheliche Partnerschaft von Mann und Frau nur als Konkurrenz und Bedrohung der Ehe aufgefaßt werden können. In der Wirklichkeit unserer Tage leben wir aber in der Bundesrepublik mit über 10 Millionen Erwachsenen zusammen, die auch jenseits des 25. Lebensjahres ledig oder als verwitwete und geschiedene alleinstehend sind. Diese sind darauf angewiesen, daß die Kooperation von Männern und Frauen, seien sie verheiratet oder ledig bzw. alleinstehend, im beruflichen, politischen und gesellschaftlichen Bereich gelingt. In der Großfamilie der vor-und frühindustriellen Zeit konnten die Kinder frühzeitig sozialisierende Erfahrungen mit erwachsenen Bezugspersonen, die nicht ihre Väter und Mütter waren, machen.
Die Entwicklung der Fähigkeit zur Übernahme der eigenen Geschlechtsrolle wird für die Kinder behindert, die als Einzelkinder oder in gleichgeschlechtlichen Geschwistergruppen aufwachsen. Selbst bei Familien mit drei Kindern ist es nicht selten, daß alle drei nur Jungen oder nur Mädchen sind.
214
Auf diese Weise lernt ein Großteil der Kinder in unserer Gesellschaft keine gegengeschlechtlichen Altersgenossen im Intimbereich der Familie kennen und kann also nicht frühzeitig Erfahrungen im Umgang mit dem anderen Geschlecht sammeln. Das Erfahrungsdefizit reicht von der Unkenntnis der äußeren Gestalt und der emotionalen Haltung der gegengeschlechtlichen Altersgenossen bis zur Einübung zwischengeschlechtlicher Partnerschaft und kann sich in der Pubertät in gesteigerter Neugier oder Angst, in Unbeholfenheit oder Übererwartung dem anderen Geschlecht gegenüber auswirken.
Keine rationale Information und kein noch so gutes Bildmaterial vermögen diesen Sozialisationsmangel der Familie mit ein bis zwei Kindern - im Augenblick 60% aller Familien, und diese Zahl scheint im Steigen begriffen - wieder wettzumachen.
Noch deutlicher als bei der Sexualität zeigt sich diese Notwendigkeit erweiterter Sozialisationsräume über die Kleinfamilie hinaus in bezug auf die Aggressivität. Einerseits ist die heutige Kleinfamilie hier noch stärker gezwungen, unkultiviertes Agieren zu unterdrücken, was zur unbewußten Verdrängung der Aggression durch den einzelnen führt, und andererseits stellt das verdrängte Aggressionspotential in unserer Gesellschaft die stärkste Bedrohung dar. Die Ideologie der Familie, als einer harmonischen Gemeinschaft, in der Konflikte, wie z. B. Rivalität zwischen Geschwistern, nicht sein dürfen, erzeugt destruktive Aggressionen. Für die Bewältigung der Aggressionsproblematik unserer Gesellschaft gilt es daher, bereits in der Familie die Bereitschaft zu entwickeln, daß Konflikte ernst genommen werden. Sie sind schon bei kleinen Kindern nicht dadurch zu regulieren, daß man sie leugnet oder wegschafft, sondern dadurch, daß man sie wahrnimmt und austrägt. Je größer der eigene Rollenspielraum und die Distanzierungs-möglichkeiten von den übrigen Familienangehörigen sind, desto leichter ließe sich möglicherweise die hier geforderte Haltung verwirklichen.
Die neuen Formen des Zusammenlebens in den westlichen demokratischen Gesellschaften unterscheiden sich gegenüber den vorindustriellen Familienstrukturen durch die Freiwilligkeit des Zusammenschlusses, durch die eigene Entscheidung über das Ausmaß der gewünschten Gemeinsamkeit und ihre innere Gestaltung sowie durch die Möglichkeit, wieder auseinanderzugehen. Diese Merkmale unterschieden bereits die Kleinfamilie, die sich im Zuge der industriellen Entwicklung bisher durchgesetzt hat, von der Großfamilie alten Stils. Sie wird sicher noch auf lange Sicht die vorherrschende Familienform bleiben. Viele Kulturen entwickeln sich ja erst jetzt zur Kleinfamilie hin, und auch in allen neuartigen Experimenten bleibt die Lebenseinheit Vater-Mutter-Kind als Keimzelle menschlichen Lebens erhalten.
215
Die Überlegungen der Beteiligten gehen in den skandinavischen Ländern und zum Teil auch bei uns stärker in die Richtung, ob die Bedingungen für die notwendige zweite, die sozio-kulturelle Geburt des Menschen nicht verbessert werden könnten, wenn die Kleinfamilie aus ihrer bisherigen Isolierung heraustritt. Diese Entwicklung würde auch die weitere Emanzipation der Frau ermöglichen. Die Tendenzen, die in der Kleinfamilie festzustellen sind, schaffen aber überhaupt erst die Voraussetzungen für weitere Wandlungen in der Zukunft. Darum gilt es zunächst, die neue Realität der Kleinfamilie ins Auge zu fassen und die zu ihrer Bewältigung notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
Was ist eigentlich das Besondere an der heutigen Familie? Zunächst einmal müssen wir feststellen, daß Familien nicht mehr einfach als vorgegebene Einheiten vorhanden sind und sich von Generation zu Generation durch die Heirat der Erben fortsetzen. Heute werden Familien immer wieder neu gegründet, indem ein Mann und eine Frau die Entscheidung fällen, zu heiraten und Kinder zu haben. Diese Entscheidung für die Ehe steht in der Gegenwart prinzipiell jedem erwachsenen Glied unserer Gesellschaft offen. Es gibt keine Heiratsbeschränkungen mehr. Dabei ist nicht nur der Eintritt in die Ehe, sondern auch die Wahl der Partner grundsätzlich frei. Dynastische und ökonomische Gesichtspunkte, Versorgungs- und Erbfolgerücksichten spielen nur noch eine geringe Rolle, und die Liebesheirat, früher das Privileg einiger Auserwählter, ist heute die Regel geworden. Im Verlauf der Ehe behält das Verhältnis der Partner zueinander neben den Eltern-Kind-Beziehungen seinen Eigenwert. Die Ehe geht damit nicht mehr notwendigerweise in der Elternschaft auf. Diese Entwicklung wird durch die zunehmende Empfängnisregelung unterstützt. Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt darin, daß sich bestimmte Phasen der Ehe herausbilden, je nachdem, ob noch keine Kinder vorhanden sind, die Kinder klein oder groß sind, ob sie das Elternhaus wieder verlassen haben. In jeder dieser Phasen sind die Selbständigkeit der Gattenbeziehungen und die freie Beweglichkeit des einzelnen Ehepartners, besonders der Frau, unterschiedlich groß. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Stichwort für die herausgehobenen Merkmale von Ehe und Familie heute scheint der Gedanke der Offenheit am besten geeignet, um den Wandel gegenüber früher zum Ausdruck zu bringen. Der Beginn der Ehe, ihre innere Gestaltung und ihr mögliches Ende sind - von schicksalhaften Einschränkungen abgesehen - in gleicher Weise offen für persönliche Entscheidungen. Erst diese Offenheit ermöglicht die Durchsetzung einer wirklich partnerschaftlichen Ehe, denn sie ist zugleich die Voraussetzung dafür, daß beide Partner, also nicht nur der Mann, die gleichen Chancen erhalten, in ihrer Ehe auch sich selbst zu verwirklichen.
216/217
Aus diesen Überlegungen ergeben sich zwangsläufig einige Gesichtspunkte für eine Vorbereitung auf die Ehe und Familie, die an Zukunft orientiert ist. Denn durch die Aufhebung der wichtigsten institutionellen Einschränkungen ist zwar die prinzipielle Offenheit hergestellt, faktisch ist diese Offenheit aber weithin durch eine einseitige Erziehung beeinträchtigt. So werden Jungen und Mädchen heute in der Mehrzahl noch nach Leitbildern von Mann und Frau erzogen, die aus einer patriarchalischen, agrarisch-handwerklich geprägten Gesellschaftsordnung stammen. Wenn deutsche Schüler etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, seit Generationen Schillers Glocke auswendig lernen müssen, ohne daß mit ihnen über die gesellschaftlichen Veränderungen, die seither eingetreten sind, gesprochen wird, wiederholt sich, gewollt oder ungewollt, immer wieder neu eine solche einseitige Rollenfestlegung von Mann und Frau.
Von daher kann man überspitzt formulieren: die beste Voraussetzung für die Ehe wäre die Vorbereitung auf die Ehelosigkeit. Anders ausgedrückt: nur wenn Jungen und Mädchen nicht von vornherein auf ein bestimmtes Bild von Mann (= Vater und Ernährer der Familie) und Frau (= Mutter und Hüterin des Hauses) festgelegt werden, erhalten beide Partner nicht nur prinzipiell, sondern auch faktisch die Möglichkeit, sich offen und frei hinsichtlich Ehe und Familiengründung zu entscheiden.
Das erfordert in erster Linie ein Umdenken in bezug auf die Ausbildung der jungen Mädchen, die nicht mehr nach dem Motto erfolgen darf: eine längere profilierte Berufsausbildung lohnt sich nicht, weil Mädchen ja doch bald heiraten. Nur wenn diese Einstellung überwunden wird, kann eine junge Frau gelassen und unabhängig der Partnerwahl und Ehegründung entgegensehen, ohne ständig unter dem Druck zu stehen, hoffentlich bald einen Mann zu bekommen, um der lästigen untergeordneten und daher nicht befriedigenden Berufstätigkeit zu entgehen. Nur solche Frauen haben eine Chance, in den „kinderlosen" Phasen der Ehe eine ihren Gaben und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe außerhalb des Hauses zu finden. Und schließlich sind so vorgebildete Frauen auch eher in der Lage, ihren Ehemännern und heranwachsenden Kindern ebenbürtige Gesprächspartner zu sein, deren Interessenbereich über die eigenen vier Wände hinausreicht.
Ein weiterer Faktor, der die Offenheit der Eheschließung zumindest zeitlich immer noch stark einschränkt, ist die Häufigkeit der vorehelichen Schwangerschaften. Dadurch werden viele junge Paare, auch wenn sie ohnehin heiraten wollten, gezwungen, zu einem so frühen Termin zu heiraten, daß beiden Partnern die Zeit fehlt, sich noch besser kennenzulernen, die Berufsausbildung voranzutreiben und in der persönlichen Entwicklung weiterzukommen. Wiederum sind in erster Linie die jungen Frauen die Leidtragenden.
Die verantwortliche Empfängnisregelung der verlobten und jung-verheirateten Paare gehört deshalb zur unerläßlichen Voraussetzung für Ehe- und Familiengründung heute, damit die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und die Gestaltung der Partnerschaft nicht zu früh durch eine ungewollte Elternschaft gestört werden und am Anfang der Ehe bereits Modelle für die späteren kinderlosen Jahre gesetzt werden können.
Die Partnerschaft von Mann und Frau in der Ehe setzt sich immer mehr durch. Trotzdem ist es nach wie vor notwendig, ein solches partnerschaftliches Miteinander zu üben. Deshalb sollten junge Menschen möglichst viel Gelegenheit haben, sich auch vor der Ehe in der Schule, im Gemeindekreis, im Betrieb, im Verein und bei der Beschäftigung mit einem Hobby als gleichwertige, gleich ehrgeizige, gleich tüchtige Partner und Konkurrenten, Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzte und Untergebene zu erleben.
Die Bereiche ehelicher Gemeinschaft, in denen sich ein solcher partnerschaftlicher Umgang miteinander später fruchtbar auswirken kann, haben sich gegenüber früher keineswegs verringert. Sie haben sich jedoch gewandelt und differenziert. Die eheliche Gemeinschaft umfaßt mehr als die Geschlechtsgemeinschaft. Diese ist vielmehr nur ein Teilaspekt eines umfassenden gemeinsamen Lebens, und sie wird nur in dem Maße gelingen, wie dieses gemeinsame Leben überhaupt gelingt. Im Augenblick sieht es allerdings so aus, als wenn immer mehr Menschen sich von dem umgekehrten Weg eine Erneuerung ihres Lebens und Zusammenlebens erhoffen. Das Gelingen sexuell-genitaler Kontakte erscheint vielen, wie in einem Teil der Massenmedien propagiert, als der entscheidende Schritt zu einem neuen Menschen. In Wirklichkeit erweist sich diese Hoffnung als trügerisch. Sie übernimmt vielmehr die Funktion der mittelalterlichen Jenseitshoffnung, indem sie den Menschen von der Notwendigkeit ablenkt, die bedrückenden Verhältnisse, in denen er lebt, zu verändern.
Die Hoffnung auf einen neuen Menschen, von der in diesem Aufsatz die Rede war, zielt auf eine ganzheitliche Befreiung des Menschen von seinen Abhängigkeiten, die in ihm selbst und in seiner Umwelt begründet sein können. Nur der in dieser Weise beweglich gewordene Mensch, der auf keine konservative oder progressive Ideologie festgelegt ist, kann die in der Gegenwart gegebenen Möglichkeiten voll ausschöpfen und für die Zukunft fruchtbar machen. Den neuen Menschen, der hier gemeint ist, charakterisiert die Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen lebensfördernd zu gestalten.
Die Voraussetzungen hierfür sind heute in zweifacher Hinsicht besser geworden: Einerseits nimmt die bewußte Wahrnehmung der Wirklichkeit und der vorhandenen Probleme in vielen Bereichen zu. Andererseits bieten die anthropologischen Forschungen dieses Jahrhunderts die Möglichkeit, daß sich Haltungs- und Einstellungsänderungen beim einzelnen und in der Gruppe vollziehen. Beides, die unvoreingenommene Wahrnehmung der Realität wie deren Veränderung, sind dem Menschen möglich, der die Welt als zu gestaltendes Gegenüber und sich selbst als in ständigem Wandel befindlich erleben kann. Auf einen solchen Menschen richtete sich auch die große Hoffnung, die am Anfang unserer westlich-abendländischen Kultur- und Geistesgeschichte stand. Christen mögen darin eine Ermutigung sehen, mit allen denen zusammenzuarbeiten, die sich in der Gegenwart dafür einsetzen, daß der Mensch fähig wird, die Zukunft zu bestehen.
217-218
#
Benutzte und weiterführende Literatur:
Dieter Claessens: Familie und Wertsystem; Soziologische Abhandlungen, Heft 4, Duncker & Humblot Berlin 1967
Erik H. Erikson: Einsicht und Verantwortung; Die Rolle des Ethischen in der Psychoanalyse, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1966
Arnold Gehlen: Anthropologische Forschung; Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen, Hg Ernesto Grassi, Universität München, Rowohlt 1965
Siegfried Keil: Sexualität; Erkenntnisse und Maßstäbe, Kreuz-Verlag Stuttgart 1966
Siegfried Keil: Aggression und Mitmenschlichkeit; Kreuz-Verlag Stuttgart 1970
Konrad Lorenz: Das sogenannte Böse; Zur Naturgeschichte der Aggression, Dr. G. Borotha-Schoeler Verlag Wien 1966
Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft; Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud, Band 158, Suhrkamp Verlag 1967
Alexander Mitscherlich: Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität, Band 233, Suhrkamp 1969
Dietrich von Oppen: Der sachliche Mensch, Frömmigkeit am Ende des 20. Jahrhunderts, Kreuz-Verlag Stuttgart 1968
Arno Plack: Die Gesellschaft und das Böse, Eine Kritik der herrschenden Moral, Paul List Verlag KG München 1968
Hermann Schempp: Gemeinschaftssiedlungen auf religiöser und weltanschaulicher Grundlage, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1969
Dorothee Sölle: Phantasie und Gehorsam, Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, Kreuz-Verlag Stuttgart 1968
Wolfgang Wickler: Sind wir Sünder? Naturgesetze der Ehe, mit einer Einführung von Konrad Lorenz, Droemer-Knaur Nachf. München 1969
Die junge Arbeiterin, Herausgeber Gerhard Wurzbacher, 3. Auflage, München 1960
219
#
https://gsp-ev.de/nachruf-prof-dr-theol-dr-phil-siegfried-keil/ 2018
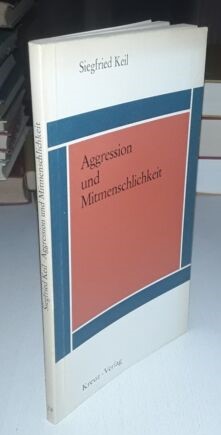
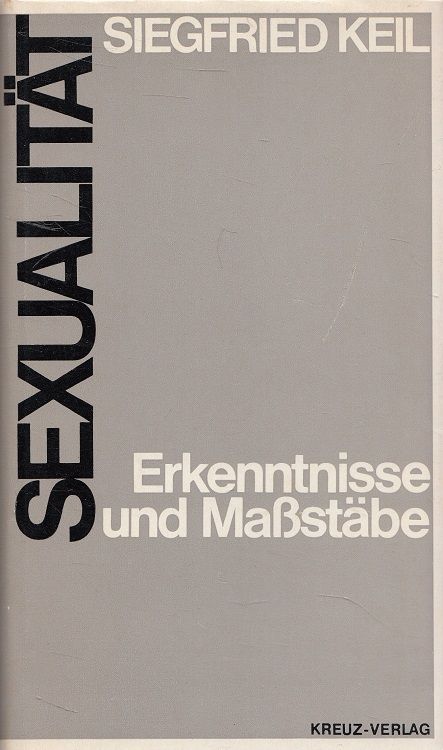
Siegfried Keil 1971 - evangelischer Theologe und Sozialethiker - wikipedia Siegfried_Keil *1934 in Kiel bis 2018 dnb.Person dnb.Nummer (28)